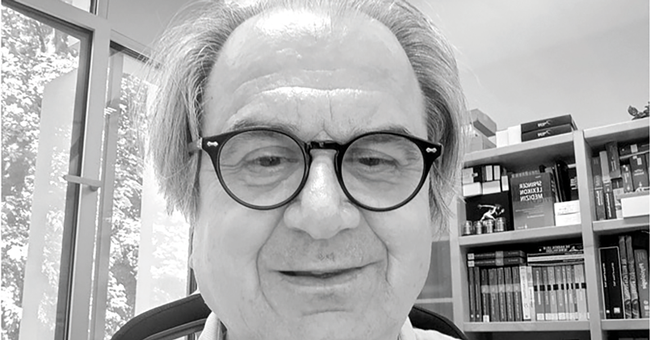Um klinische Studien durchführen zu können sowie den Therapieverlauf und die Effekte von Anti-Aging-Maßnahmen beurteilen zu können, ist es notwendig, den Behandlungsfortschritt messbar zu machen. Dazu können verschiedene Biomarker herangezogen werden. Visuelle Biomarker wie Falten, der Zustand der Haut oder graue Haare sind dabei schwierig zu objektivieren. Durch KI-basierte Applikationen ist es bereits jetzt möglich, über 3D-Kameras das biologische Alter zu bestimmen. Diese Methoden sind jedoch auf bestimmte ethnische Gruppen trainiert, sodass die Bestimmungen von Menschen einer anderen Ethnie nicht zuverlässig sind.
Besser geeignet sind daher funktionelle Biomarker, die die Funktionsfähigkeit des Körpers messen. Darunter fallen z. B. die Griffkraft, die Gehgeschwindigkeit und der Aufstehtest. Daraus ist der Frailty-Index, eine Art Gebrechlichkeitsskala, entstanden, der auch soziologische Faktoren berücksichtigt. Laut Schosserer könnte sich künftig die Bestimmung dieser funktionellen Biomarker am besten eignen, um das funktionelle Alter in Apotheken zu erheben.
Molekulare Biomarker
Messgrößen auf molekularer Ebene wie z. B. die Blutchemie, Telomerlänge, Methylierungsmuster und miRNAs (microRNA) haben den Vorteil, dass sie – wenn auch technisch aufwändig – objektiv quantifizierbar sind. Nicht alle dieser Biomarker lassen aber valide Rückschlüsse zu. So stellen zahlreiche Studien die Aussagekraft der Telomerlänge als Biomarker infrage.
Zelluläre Zeitmesser
Eine neue Entwicklung, die erst durch die steigende Rechenleistung und künstliche Intelligenz ermöglicht wurde, stellen epigenetische Uhren dar. Sie bestimmen das Alter auf Grundlage epigenetischer Veränderungen wie Methylierungsmuster der DNA und Histone. Durch KI-gestützte Methoden lässt sich aus diesen Informationen eine Korrelation mit dem chronologischen Alter errechnen. Die Horvath-Clock aus dem Jahr 2013 ist laut Schosserer der bislang beste Marker für das chronologische Alter. Mit epigenetischen Uhren wie GrimAge und PhenoAge sollen sich künftig auch Krankheitsrisiken und die Sterblichkeit besser vorhersagen lassen. Aktuell sind epigenetische Uhren in Entwicklung, die verschiedene Gewebe (pan-tissue clock), verschiedene Spezies (pan-species clock) oder auch nur eine einzelne Zelle (single-cell clock) messen. Die Reproduzierbarkeit epigenetischer Uhren und ihre Korrelation mit dem biologischen Alter ist jedoch umstritten. Die aktuelle DO-HEALTH-Studie untersuchte an 777 Teilnehmer:innen über drei Jahre hinweg verschiedene Maßnahmen wie die tägliche Einnahme von Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren, ein Trainingsprogramm sowie deren Kombinationen. Dabei zeigte sich, dass die vier verwendeten epigenetischen Uhren keine zuverlässigen Aussagen über das biologische Alter lieferten. Denn während Omega-3-Fettsäuren einen positiven Effekt auf das epigenetische Alter hatten, waren die Ergebnisse zur Vitamin-D-Einnahme widersprüchlich, und Training, dessen positive Wirkungen hinlänglich bewiesen sind, hatte keinerlei Effekt.
RNA-Modifikationen
Ribosomale RNA-Modifikationen, die sogenannten Epitranscriptomics, sind ein relativ neues Forschungsgebiet. Auch sie können als Biomarker dienen, da sie mit der Lebensspanne assoziiert sind. RNA-Modifikationen sind für die normale Ribosomenfunktion essenziell: Sie stabilisieren die Struktur der RNA, ermöglichen deren Bindung an die Ribosomen und regulieren die Immunfunktion. Durch Veränderungen in den Modifikations-Mustern der RNA können seneszente und nicht-seneszente Zellen unterschieden werden.
Im Tierversuch erhöhte das Ausschalten des NSUN5-Gens, das in zahlreichen Krebsarten aktiv ist, die gesunde Lebenszeit von Mäusen und verbesserte den klinischen Frailty-Index. Es führte jedoch auch zur Reduktion des Körpergewichts, der Knochendichte und der Lymphozyten. In der freien Natur wären die Tiere daher nicht lebensfähig, da sie über kein funktionierendes Immunsystem mehr verfügen. „Nun geht es darum herauszufinden, wie die negativen Effekte von den positiven entkoppelbar sind“, so Schosserer.