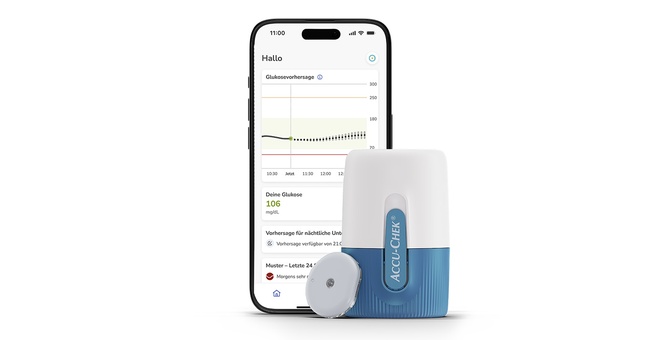Das Institut für Foresight und Technikfolgen-Abschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW-ITA) definiert DiGA als „evidenzbasierte, softwaregesteuerte therapeutische Interventionen zur Vorbeugung, Verwaltung oder Behandlung einer medizinischen Störung oder Krankheit“. DiGA richten sich nicht an Ärzt:innen, sondern sind patientenorientierte Softwareanwendungen. Sie sollen Anwender:innen – zu denen nicht nur bereits Erkrankte, sondern auch noch Gesunde zählen – bei der Behandlung, Vorbeugung oder Bewältigung einer Krankheit helfen und dabei eine nachgewiesene klinische Wirkung entfalten. Ärztliche oder psychotherapeutische Konsultationen bzw. Behandlungen sollen auf diese Weise durch DiGA unterstützt werden.
Von anderen Lifestyle- oder Gesundheitsapps sind digitale Gesundheitsapps jedoch abzugrenzen. DiGA sind behördlich geprüft und streng reguliert. Sie unterliegen der EU-Medizinprodukte-Verordnung (Medical Device Regulation, MDR) und sind CE-gekennzeichnete Medizinprodukte der Risikoklasse I oder II. Auch in puncto Datenschutz gelten strenge Vorschriften.

Einige europäische Länder haben DiGA bereits fest in die Versorgung integriert. Neben Deutschland, wo sie bereits im Jahr 2019 eingeführt wurden, sind das Belgien, Frankreich, die Schweiz, England, die Niederlande und Dänemark.
Verordnungshäufigkeit und Stellenwert
in Deutschland
- 2022 wurden 271 digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) je 100.000 Einwohner:innen verordnet oder beantragt, 2021 waren es noch 128 je 100.000 Einwohner:innen. Bei Frauen wurden etwa doppelt so viele DiGA wie bei Männern verordnet (oder beantragt).
- DiGA werden überwiegend bei Personen im Erwerbsalter verordnet.
- Mehr als die Hälfte aller DiGA-Verordnungen im Jahr 2022 ließen sich 3 von 18 Anwendungskategorien zuordnen (Bewegungsapparat, Adipositas, Tinnitus).
- Psychotherapie-Patient:innen waren mit einem Anteil von 0,3 % am häufigsten Anwender:innen von DiGA-Verordnungen.
- Die Anzahl der DiGA-Verordnungen innerhalb von drei Jahren ist in etwa so hoch wie die jährlich zur Darmkrebsvorsorge durchgeführten Koloskopien.
- Die Entwicklung steht jedoch noch am Anfang. Durch die Verjüngung der Altersstruktur bei Behandler:innen und nachfolgenden, technikaffineren Patientengenerationen ist von einer deutlichen Zunahme der Verordnungszahlen auszugehen.2
Bisherige Rezeption
Eine Umfrage unter 1.000 deutschen Ärzt:innen ergab, dass ein Drittel der Befragten ihren Kenntnisstand zu DiGA als schlecht oder sehr schlecht einschätzten, obwohl 95 % grundsätzlich von der Möglichkeit zur Verordnung von DiGA wussten. Jedem/jeder Zweiten war das DiGA-Verzeichnis unbekannt.2 Der deutsche Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherungen berichtet zudem, dass von September 2020 bis Oktober 2023 17 % der an die Versicherten ausgegebenen Freischaltcodes zur Aktivierung der Apps nicht eingelöst wurden. Und viele Nutzer:innen dürften die Apps nicht langfristig nutzen, denn 15 % der Anwender:innen verwendeten die App innerhalb von vier Wochen nicht mehr.2
Erstattungsmodalitäten in Deutschland
Damit eine DiGA in Deutschland von Ärzt:innen oder Psychotherapeut:innen verordnet und von den Krankenkassen erstattet werden kann, muss sie nach der Zulassung nach MDR durch das deutsche Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in das DiGA-Verzeichnis aufgenommen werden (https://diga.bfarm.de/de). Dies geschieht im Rahmen eines eigens dafür geschaffenen nationalen Zulassungsverfahrens („Fast-Track-Verfahren“), bei dem überprüft wird, ob die Herstellerangaben zu Funktionstauglichkeit, Sicherheit, Datenschutz und Produkteigenschaften den Vorgaben entsprechen. Darüber hinaus muss die DiGA über einen sogenannten „positiven Versorgungseffekt“ verfügen. Das bedeutet, dass Nutzer:innen der App einen positiven Effekt gesundheitlichen Effekt beobachten können. Ist die App in das DiGA-Verzeichnis aufgenommen, kann sie verordnet werden.8,9
Schwammiger Begriff
Das deutsche Arzneitelegramm kritisierte bereits im Vorjahr den niederschwelligen Marktzugang für DiGA, da unter der Bezeichnung „positive Versorgungseffekte“ nicht nur Nachweise des medizinischen Nutzens, sondern auch „patientenrelevante Struktur- und Verfahrensverbesserungen“ akzeptiert werden, also z. B. eine Förderung der Gesundheitskompetenz oder Adhärenz.3 Problematisch ist auch, dass eine DiGA selbst bei fehlendem Wirknachweis eines positiven Versorgungseffektes ein Jahr lang im DiGA-Verzeichnis „vorläufig gelistet“ – und somit auch erstattet – werden kann. Diese Zeitspanne kann auf bis zu zwei Jahre verlängert werden. Die DiGA-Entwickler können dabei im ersten Jahr nach Aufnahme in das Verzeichnis den Preis für ihre Anwendungen selbst festlegen. Dieser ist von den Krankenkassen auch bei lediglich vorläufig aufgenommenen Apps zu bezahlen. Nur bei dauerhaft im Verzeichnis des BfArM gelisteten DiGA ist der Nutzen belegt. Im Mai 2025 war dies bei 44 von insgesamt 69 aktiven DiGA der Fall. 25 (36 %) waren nur vorläufig aufgenommen. Dieser Anteil war im August 2024 ebenso hoch.7
Studien mit Qualitätsmängeln
Die Studien zum Nachweis Versorgungseffekte entsprechen laut einer Aussendung des Arzneitelegramms aus dem Vorjahr7 zudem häufig nicht jenen Standards, die für andere verordnungsfähige Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen bestehen.11,12 Der Nachweis auf einen therapeutischen Nutzen oder auf patientenrelevante Vorteile hat also deutlich geringere Anforderungen als bei Arzneimitteln. So liegen u. a. Qualitätsmängel wie irrelevante Endpunkte, ein hohes Verzerrungspotenzial oder kurze Nachbeobachtungszeiten vor. Weitere Mängel sind das Fehlen aktiver Kontrollen und fehlende Angaben zur statistischen Auswertungen im Studiendesign.9
Auch in einer aktuellen Aussendung bleibt das Arzneitelegramm bei dieser Einschätzung. DiGA könnten ärztliche Therapien grundsätzlich ergänzen und das Selbstmanagement von Erkrankungen fördern. Laut Branchenverband liegt zwar für alle dauerhaft gelisteten DiGA mindestens eine randomisierte Studie vor – mehr als gesetzlich gefordert wäre. Krankenkassen und Fachgruppen kritisieren jedoch die methodische Qualität dieser Studien: Häufig fehlen Verblindung, objektive Endpunkte und Vergleichsstudien innerhalb von Indikationsgebieten. Hohe Abbruchquoten und nicht-repräsentative Rekrutierung über das Internet schränken zudem die Aussagekraft ein. Als Ursache wird lt. Bundesgesundheitsblatt u. a. auch das wenig anspruchsvolle Fast-Track-Verfahren des BfArM gesehen, das etablierte Bewertungsstandards der gesetzlichen Krankenkassen umgeht. Insgesamt beschreibt der Spitzenverband der deutschen gesetzlichen Krankenkassen die Nutzenbelege für DiGA als „ernüchternd“.
Diese Mängel sind deswegen besonders heikel, da DiGA auch der Risikoklasse IIb unterliegen können, bei denen bei Fehlfunktion eine schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustandes droht.
| Beantragungen, Genehmigungen und Erstattungen der im Jahr 2022 zehn häufigsten beantragten DiGA (Deutschland) | |||||||
| Rang | DiGA-Name | Anwendungskategorie (Rang und Zahl der DiGA innerhalb der Kategorie) | Beantragung | Anteil Folgeanträge | Anteil Genehmigung | Erstattungen* | Betrag (MW) |
| Anzahl | Prozent | Prozent | Anzahl/Prozent | Euro | |||
| 1 | Vivira | Bewegungsapparat (1 von 4) | 32.932 | 13,6 | 98,8 | 24.205/74,4 | 240 |
| 2 | Kalmeda | Tinnitus (1 von 2) | 29.553 | 23,1 | 98,8 | 23.788/81,5 | 196 |
| 3 | zanadio | Adipositas (1 von 2) | 29.455 | 31,6 | 94,8 | 25.965/93 | 500 |
| 4 | somnio | Schlafstörungen (1) | 16.886 | 13,3 | 99,2 | 14.489/86,5 | 226 |
| 5 | deprexis | Depressionen (1 von 3) | 14.102 | 3,8 | 98,9 | 11.221/80,4 | 232 |
| 6 | Oviva Direkt | Adipositas (2 von 2) | 11.677 | 8,1 | 97,6 | 9.738/85,5 | 401 |
| 7 | Selfpapys Online- Kurs bei Depression | Depressionen (2 von 3) | 11.247 | 7,5 | 97,4 | 8.607/78,6 | 458 |
| 8 | companion patella | Bewegungsapparat (2 von 4) | 11.106 | 4,6 | 98,8 | 8.439/76,9 | 345 |
| 9 | Kranus Edera | Erektions- störungen (1) | 7.611 | 11,4 | 73,8 | 4.590/81,8 | 651 |
| 10 | velibra | Angststörungen (1 von 8) | 5.645 | 14,5 | 98,4 | 4.387/79 | 291 |
| MW: Mittelwert, * Erstattungen nach Daten mit Dokumentationsstand Ende September 2023, Anteil in Prozent bezogen auf genehmigte DiGA. Quelle: Barmer Arztreport 20242 | |||||||
Situation in Österreich
In Österreich existiert derzeit zwar noch kein standardisierter Prozess, um ein digitales Gesundheitsprodukt durch die Krankenkassen erstatten zu lassen, durch die MDR und das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG) ist eine individuelle Refundierung jedoch auch jetzt schon möglich. Die Erstattung wird allerdings nur in Einzelfällen gewährt. Im Jahr 2018 gaben 9 von 16 Versicherungen an, insgesamt 22 DiGA zur Verfügung zu stellen. Großteils handelte es sich dabei um präventive Anwendungen. Auch eine einheitliche Qualitätskontrolle gibt es bisher nicht, allerdings wurde bei 15 der Apps eine Qualitätsprüfung durchgeführt, bei zehn Tests hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit.
Das Austrian Institute of Health Technology Assessment (AIHTA) hat sich jedoch bereits im Jahr 2020 mit DiGA befasst und dabei verschiedene Refundierungsansätze untersucht.
- Durch den Hersteller: CE-Kennzeichnung und Einordnung nach Risikoklassen basierend auf der MDR
- Durch die AGES: Festlegung der notwendigen Evidenznachweise aufgrund der Risikoklasseneinordnung
- Durch den Dachverband der Sozialversicherungen: Zulassung als erstattungsfähige DiGA; Kriterien: klinische Wirksamkeit/Sicherheit, zu erwartende Kosten im Gesundheitssystem, Datensicherheit, Datenschutz, Bedienbarkeit/Gebrauchstauglichkeit
In der im Juni 2024 veröffentlichten eHealth-Strategie Österreich des BMASGKP sind konkrete Maßnahmen zur Gestaltung eines Zulassungsprozesses für DiGA festgelegt. So soll zwischen 2024 und 2026 ein einheitlicher Bewertungsprozess u. a. von DiGA etabliert werden. Geht aus digitalen Gesundheitsanwendungen generell ein (medizinischer) Nutzen hervor, sollen DiGA in die Gesundheitsversorgung eingeführt werden.
Anforderungen an DiGA
- Erfüllt die Anforderungen nach Medizinproduktegesetzgebung
- CE-Prüfungsverfahren für digitale Medizinprodukte
- Strenge Vorschriften zum Datenschutz und zur
Datensicherheit, auch über die DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) hinausgehend - Der Nutzennachweis ist durch klinische Studien bewertet und überprüft.
Quelle: Positionspapier AustroMed, PHARMIG, 20233
Von August 2024 bis Ende Februar 2025 lief ein Pilotverfahren zur Schaffung eines österreichischen DiGA-Prozesses. Darin sollen die bisher erarbeiteten Bewertungskriterien für DiGA einem Praxistest unterzogen werden. Initiator ist der Dachverband der Sozialversicherungen.
Seit Februar befindet sich das Projekt in der Umsetzungsphase, bis 2026 soll ein entsprechender Prozess zur Bewertung von DiGA eingeführt sein.13
Quellen
- Jeindl R, Wild C. Framework zur Unterstützung von Refundierungsentscheidungen zu digitalen Gesundheitsanwendungen (mHealth) und dessen (retrospektive) Anwendung an ausgewählten Beispielen. AIHTA Projektbericht Nr.: 134; 2020. Wien: HTA Austria – Austrian Institute for Health Technology Assessment GmbH.
- Grobe T G et al., BARMER Arztreport 2024, Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse – Band 45, Digitale Gesundheitsanwendungen –
DiGA, BARMER, Postfach 110704, 10837 Berlin, ISBN 978-3-946199-93-9 - Positionspapier AustroMed, PHARMIG, Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) (Update 2023),
https://www.pharmig.at/media/6141/diga_positionspapier_2023-final.pdf?download=1&v=638318545508630000&ipignore=true, Zugriff am 4.6.2025 - Hong, J. S., Wasden, C. und Han, D. H., 2021, Introduction of digital therapeutics, Computer Methods and Programs in Biomedicine 209.
- Kampouraki, D., 2021, Digital therapeutics, in: Thomas Zerdick und Stefano Leucci, TechSonar 2021-2022 Report,: EDPS.
Weitere Literatur auf Anfrage
-Foto-Weinwurm-GmbH.jpg)