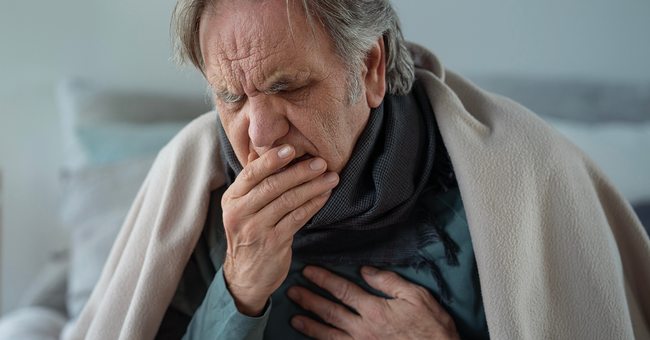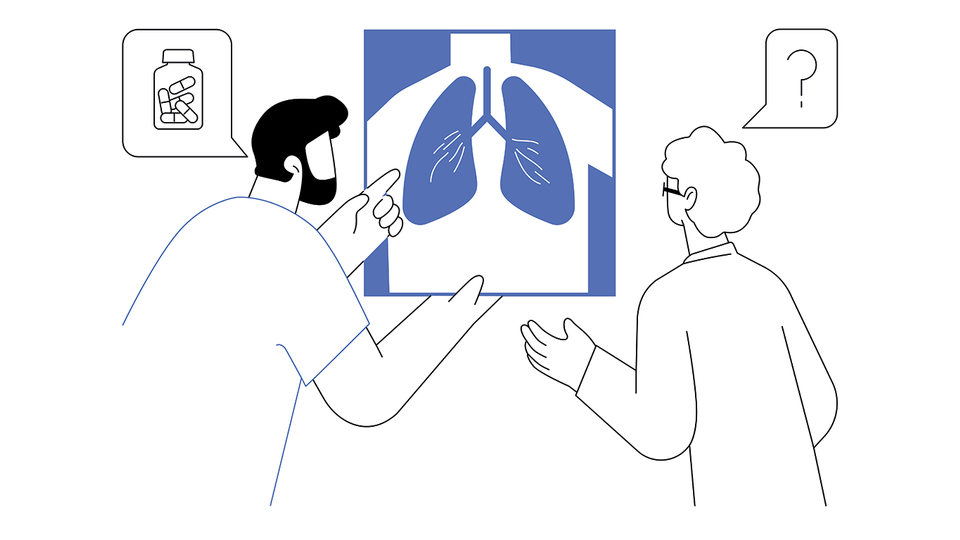
Bei COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) handelt es sich um eine chronische und in der Regel progrediente Atemwegs- und Lungenerkrankung. Ein typisches Merkmal ist die durch die Gabe von Bronchodilatatoren nicht vollständige reversible Atemwegsobstruktion. Charakteristischerweise geht COPD mit einer chronisch obstruktiven Bronchitis (COB), gekennzeichnet durch dauerhaften Husten und Auswurf über mindestens ein Jahr und/oder ein Lungenemphysem (Überblähung der Lungenbläschen, Verringerung der Gasaustauschfläche der Lunge) einher.
Risikofaktoren
Der bedeutendste Risikofaktor ist die Exposition gegenüber Tabakrauch – inklusive Passivrauchen. Darüber hinaus erhöhen auch inhalativ konsumierte alternative Tabakprodukte wie E-Zigaretten, Wasserpfeifen und Tabakerhitzer das Risiko. Inhalative Noxen am Arbeitsplatz sowie Umweltbelastungen (z. B. Luftverschmutzung, Biomassenexposition) tragen ebenfalls wesentlich zur Entstehung einer COPD bei. Bereits pränatale Einwirkungen und solche in der Frühkindheit, wiederholte Atemwegsinfektionen im Kindesalter und eine durchgemachte Tuberkulose können die Anfälligkeit zusätzlich steigern. Ein niedriger sozioökonomischer Status ist häufig mit höherer Exposition und schlechterem Zugang zu Prävention und Betreuung verknüpft. Auch genetische Faktoren – insbesondere ein Alpha-1-Protease-Inhibitor-Mangel – spielen eine Rolle. Zudem gelten bronchiale Hyperreaktivität (Asthma) und Störungen des Lungenwachstums als relevante Risikokonstellationen. In der Regel handelt es sich um ein multikausales Geschehen, bei dem mehrere Faktoren additiv zusammenwirken.
Nichtmedikamentöse Therapie
Die nichtpharmakologische Behandlung bildet die Grundlage jeder COPD-Therapie und sollte allen Patient:innen frühzeitig und strukturiert angeboten werden. Der Verzicht auf Tabak ist die wirksamste Maßnahme, um Krankheitsprogression und Exazerbationen zu verringern. Nikotinersatztherapien und evidenzbasierte Beratungsangebote erhöhen die Erfolgsquote und sollten aktiv vermittelt werden. Regel-
mäßiges, individuell abgestuftes Ausdauer- und Krafttraining – idealerweise im Rahmen einer pneumologischen Rehabilitation – verbessert Belastbarkeit und Lebensqualität, reduziert Dyspnoe und unterstützt den Erhalt der Alltagskompetenz und Autonomie. Atemphysiotherapie kann die Ventilation verbessern, die Atemarbeit reduzieren und die Atemfunktion erhalten bzw. wiederherstellen. Sowohl untergewichtige als auch adipöse Patient:innen profitieren von strukturierter Ernährungsberatung. Die Maßnahmen sollten multiprofessionell koordiniert, regelmäßig evaluiert und an die individuelle Krankheitsphase und Zielsetzung angepasst werden.
Medikamentöse Therapie
Langwirksame Bronchodilatatoren – langwirksame Beta2-Agonisten (LABA) und langwirksame muskarinische Antagonisten (LAMA) – werden als Basis der COPD-Behandlung eingesetzt. LABA und LAMA bewirken eine anhaltende Bronchodilatation, verbessern den Luftstrom und reduzieren Exazerbationen (= akute Verschlechterungen). Als Notfallmedikation sollten alle Patient:innen kurzwirksame Bronchodilatatoren (kurzwirksame Beta2-Agonisten) verschrieben bekommen. Bei Patient:innen mit einer Exazerbationshistorie können trotz einer optimalen Bronchodilatation inhalative Corticosteroide (ICS) zusätzlich eingesetzt werden.
Patient:innen mit schwerer COPD und häufigen Exazerbationen profitieren von der Triple-Therapie. Hier werden LABA, LAMA und ICS kombiniert. Symptome werden besser gelindert, die Lungenfunktion verbessert und die Exazerbationsrate sinkt. Der Phosphodiesterase-4-Inhibitor Roflumilast wird bei schwerer COPD, chronischer Bronchitis und Exazerbationshistorie eingesetzt. Der Wirkstoff reduziert Exazerbationen und hemmt Entzündungen in den Atemwegen. Ausgewählte Mukolytika (z. B. N-Acteylcystein) können in bestimmten Fällen, z. B. bei symptomatischen Patient:innen mit überwiegend bronchitischen Beschwerden, als Dauertherapie eingesetzt werden. Sie reduzieren die Schleimviskosität, erleichtern die Sekretclearance und senken potenziell die Exazerbationsrate.
Empfohlener Impfschutz bei COPD
Um das Risiko von Atemwegsinfektion zu senken, werden folgende Impfungen empfohlen: COVID-19, Influenza, Pneumokokken, Pertussis, Herpes zoster und RSV (ab 60 Jahren).
Unterschiede im Rauchverhalten Männer vs. Frauen
Tabakrauch gehört in den Industrienationen immer noch zu den größten vermeidbaren Gesundheitsrisiken. Daher sind die Verringerung des Tabakkonsums sowie auch der Schutz vor Passivrauch wichtige gesundheitspolitische Ziele. Zu Beginn der 1970er-Jahre gab es in Österreich noch große Unterschiede der täglich Rauchenden zwischen Männern und Frauen. Über die Jahrzehnte hat sich das Rauchverhalten jedoch zusehends angeglichen, Männer rauchen heute nur noch geringfügig mehr als Frauen. E-Zigaretten sowie Wasserpfeifen/Shishas werden von Männern häufiger genutzt. Auch bei der Passivrauchexposition zeigen sich Differenzen: Besonders junge Erwachsene und wiederum Männer sind in geschlossenen Räumen überproportional häufig exponiert.
Zudem findet sich ein deutlicher sozialer Gradient: Tabakkonsum und Passivrauchexposition treten in niedrigeren Bildungsgruppen häufiger auf.
Diagnostik von COPD
Liegen Dyspnoe, chronischer Husten, Sputumproduktion und eine Vorgeschichte wiederkehrender Infektionen der unteren Atemwege vor, muss an COPD gedacht werden. Zur frühzeitigen Erkennung von COPD bei symptomatischen Patient:innen mit Risikofaktoren dient die Spirometrie (Lungenfunktionstest).
Unterschiede in der Symptomatik
Männer vs. Frauen
Zwischen den Geschlechtern bestehen Unterschiede hinsichtlich der Anfälligkeit für COPD, der Diagnostik, des Schweregrads, der Komorbiditäten, der Symptomen, des Exazerbationsrisikos, der Hospitalisierung und Sterblichkeit.
Frauen
Die Lungen von Frauen sind bei der Geburt kleiner und haben weniger respiratorische Bronchiolen. Die Atemwege von Frauen sind enger und empfindlicher gebaut. Frauen sind zu Beginn der Erkrankung jünger als Männer und haben weniger Packungsjahre (Maßeinheit für Rauchbelastung, 1 Pack-Year entspricht dem Rauchen von 20 Zigaretten pro Tag über ein Jahr). Sie haben zwar eine bessere Lungenfunktion (FEV1 %), sind aber empfindlicher und leiden häufiger unter Exazerbationen. Frauen leiden außerdem unter mehr Dyspnoe, nicht-produktivem Husten mit weniger Auswurf und klagen über mehr Müdigkeit. Häufige Begleiterkrankungen sind u. a. Angststörungen, Depression und Osteoporose. Weibliche COPD-Betroffene haben aber eine bessere Prognose und Langzeitüberlebensrate.
Männer
Männliche Patienten leiden mehr unter produktivem Husten mit Sputum und haben ein höheres Emphysemrisiko. Die Luftnot tritt hier später im Krankheitsverlauf auf, zudem haben Männer eine geringere Exazerbationsrate. Typische Begleiterkrankungen bei Männern sind kardiovaskuläre Erkrankungen.
Einfluss der Hormone
Beobachtete Geschlechterunterschiede in der Prävalenz und Inzidenz von Lungenerkrankungen werden mit Veränderungen der Konzentration von zirkulierenden Sexualhormonen in Verbindung gebracht. Östrogen, Progesteron und Testosteron sind alle in der Lunge aktiv, haben Einfluss auf viele Zelltypen in der Lunge, beeinflussen mehrere Funktionen des Atmungssystems und spielen eine Schlüsselrolle in der Lungenentwicklung. Viele Publikationen weisen auf eine entscheidende Rolle der Sexualhormone bei Entzündungen und Erkrankungen der Lunge hin. Tiermodelle wurden verwendet, um potenzielle geschlechtsspezifische Unterschiede bei entzündlichen Lungenerkrankungen zu untersuchen. So führte beispielsweise die chronische Exposition gegenüber Zigarettenrauch zur Entwicklung emphysematöser Veränderungen in der alveolären Struktur. Diese Veränderungen entwickelten sich bei weiblichen Tieren schneller als bei männlichen.
Um die bestmögliche Versorgung von Männern und Frauen mit COPD sicherzustellen, sollte daher auf Geschlechterunterschiede Rücksicht genommen werden. Weitere Forschung in diesem Bereich ist notwendig.
Quellen
• Schmutterer I: Unterschiede im Rauchverhalten zwischen Männern und Frauen. Factsheet. Wien: Gesundheit Österreich; 2019
• Starker A, et al.: Rauchverhalten und Passivrauchbelastung Erwachsener – Ergebnisse aus GEDA 2019/2020-EHIS. Journal of Health Monitoring 2022; 7(3): 7-22
• S3-Leitlinie: Nationale Versorgungsleitlinie COPD (2021), AWMF Reg.Nr. nvl-003
• Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for prevention, diagnosis, and management of COPD: 2025 report. GOLD; 2024 Nov.Available from: https://goldcopd.org/2025-gold-report/ (abgerufen am 28.09.2025)
• Perez T, et al.: Sex differences between women and men with COPD: A new analysis of the 3CIA study. Respiratory Medicine 171 (2020); 106105
Weitere Literatur auf Anfrage