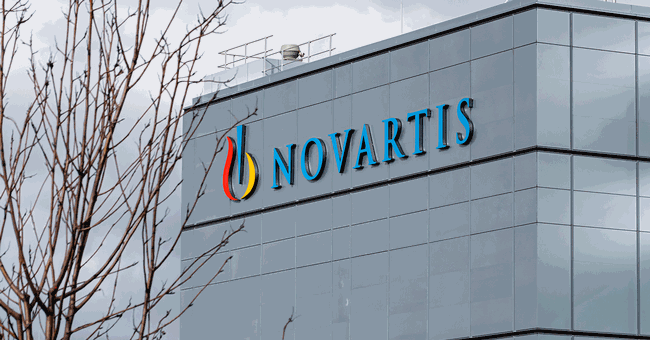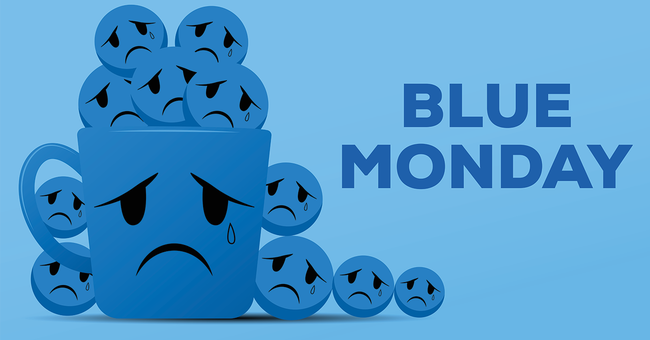Die Schlüsselblume gehört zur Familie der Primulaceae (Primelgewächse) und ist in Europa sowie in Teilen Asiens heimisch. Sie wächst bevorzugt auf Wiesen, in lichten Wäldern und an Böschungen. Von den weltweit rund 500 Primelarten werden in Mitteleuropa vor allem zwei Arten medizinisch genutzt: die Echte Schlüsselblume, auch Frühlings-Schlüsselblume (Primula veris L.), und die Hohe Schlüsselblume, auch Wald-Schlüsselblume (Primula elatior (L.) Hill.). Beide ähneln sich stark, lassen sich jedoch anhand ihrer Blüten und Standortansprüche unterscheiden. Die Echte Schlüsselblume trägt an den die Blätter überragenden Stängeln in einfachen Dolden angeordnete goldgelbe, duftende Blüten mit einem orangefarbenen Fleck im Schlund. Sie gedeiht vor allem auf trockenen Wiesen, in Gebüschen und lichten Wäldern. Die Hohe Schlüsselblume besitzt größere, blassgelbe Blüten mit goldgelbem Schlund, deren Kelch eng der Kronröhre anliegt; sie verströmt nur wenig Duft und bevorzugt feuchtere Standorte. Beide Arten bilden nach der Befruchtung kleine Kapselfrüchte mit zahlreichen Samen.
Auch die Blätter sind für die Bestimmung hilfreich: Primula veris hat kleinere, runzelige Blätter mit deutlicher Nervatur, die zur Blütezeit grundständig in einer Rosette stehen, während Primula elatior größere, weichere und weniger stark runzelige Blätter aufweist. Die Pflanzen sind ausdauernd und überwintern mit einem Rhizom und anhängendem Wurzelstock (ähnlich Baldri-an).
HIER GEHTS DIREKT ZUR FORTBILDUNG
Der Name Primula leitet sich vom lateinischen primus = „der Erste“ ab und bedeutet „kleiner Erstling“, da die bekanntesten Arten zu den ersten Frühlingsblumen zählen. Die deutsche Bezeichnung Schlüsselblume (ältere Form: Himmelschlüssel) bezieht sich auf den schlüssel-bundähnlichen Blütenstand.
Bereits in den Kräuterbüchern des 16. und 17. Jahrhunderts beschrieben Autoren wie Lonicerus und Matthiolus die Schlüsselblume als vielseitiges Heilmittel – unter anderem gegen Gicht, Herzleiden, Krämpfe und Verletzungen. In der Volksmedizin fand sie breite Anwendung bei Husten, Rheuma und Kopfschmerzen. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert wurde die Primelwurzel schließlich als starkes Expektorans geschätzt und sogar als „deutsche Senega“ betitelt. Sie wurde zur Behandlung von Bronchialkatarrhen und Pneumonie in den Arzneischatz aufgenommen.1
Medizinisch verwendet werden sowohl die Primelwurzel als auch die Schlüsselblumenblüten. Beide Drogen stammten bis vor wenigen Jahren überwiegend aus Wildsammlung in Südosteuropa und der Türkei. Im Rahmen eines Inkulturnahme-Projekts in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren wurde Primula veris aus mittel- und südosteuropäischen Herkünften auf Vielblütigkeit (Ertrag) und phytochemische Qualität gezüchtet. Der Anbau dieser „Pharma-Primel“ findet auf derzeit mehr als 150 ha im Waldviertel statt.2
Arzneilich verwendete Droge
Im europäischen Arzneibuch wird die Primelwurzel (Primulae radix) als das ganze oder geschnittene, getrocknete Rhizom und die Wurzel von Primula veris L. oder Primula elatior (L.) Hill definiert. Die Schlüsselblumenblüten sind dagegen die getrockneten, ganzen oder zerkleinerten Blüten von Primula veris L. (syn. Primula officinalis (L.) Hill) oder von Primula elatior (L.) Hill, deren Hybriden oder Mischungen dieser. Die Droge muss mindestens 3,0 % Gesamtflavonoide, berechnet als Rutosid, bezogen auf die getrocknete Droge, enthalten.
Inhaltsstoffe und pharmakologische Wirkungen
Schlüsselblumenblüten enthalten Triterpensaponine (in den Kelchblättern bis zu 2 %) sowie Flavonoide (in den Kronblättern bis zu 3 %), darunter Apigenin, Rutosid, Kaempferol-3-rutinosid und Isorhamnetin-3-glucosid (letztere zwei nur in P. elatior). Zudem kommen Caro-tinoide, Spuren von ätherischem Öl, Rosmarinsäure, D-Volemitol und weitere Zuckeralkohole vor.
Die Primelwurzel enthält vor allem Triterpensaponine (3–12 %) und phenolische Glycoside.3 Eine validierte LC-Methode erlaubt die gleichzeitige Bestimmung dieser Inhaltsstoffe und zeigte, dass P. veris durch einen höheren Gesamtgehalt an Saponinen in den Wurzeln charakterisiert ist.4 Die Saponine gehören überwiegend zum Oleanan-Typ mit verzweigten Zuckerketten. Das Hauptsaponin in den Wurzeln beider Arten ist das Primulasaponin I (Aglykon: Protoprimulagenin A), dessen verzweigte Zuckerkette über Glucuronsäure ans Aglykon gebunden ist, mit anhängender Galactose, Rhamnose und Glucose. In den Wurzeln von P. veris ist außerdem Priverosaponin-B-22-acetat, Primulasaponin II mit einer gegenüber Primulasaponin I zusätzlichen Xylose (Aglykon: Protoprimulagenin A) enthalten. Zudem findet man in den Wurzeln von P. veris Priverosaponin B (Aglykon: Priverogenin B) und Primacrosaponin (5; Aglykon: Anagalligenin A).
Die phenolischen Glycoside Primverin (das Primverosid des 4-Methoxysalicylsäuremethylesters) und Primulaverin (Primverosid des 5-Methoxysalicylsäuremethylesters) treten in beiden Arten in variablen Mengen bis 2,3 % auf, wobei der Gehalt in den unterirdischen Organen von P. veris deutlich höher ist.5 Beim Trocknen und Lagern der unterirdischen Organe entstehen daraus durch enzymatischen Abbau (durch Primverase) die charakteristischen, an Methylsalicylat erinnernden Geruchsstoffe. Typische Zucker der unterirdischen Organe sind Primverose und seltene Zucker wie Heptosen, Octulosen und Nonulosen. In den unterirdischen Organen von P. veris wurden außerdem methoxylierte Flavone und Acetophenone nachgewiesen.
Primin oder andere chinoide Verbindungen, die für die Kontaktallergie-Eigenschaften oberirdischer Pflanzenteile vor allem der Becherprimel verantwortlich sind, fehlen in den unterirdischen Organen.
Mycolytische Aktivität
Nauert et al. (2005) untersuchten den Einfluss von Flüssigextrakten aus Primelwurzel und Thymiankraut auf die LPS-induzierte Freisetzung von Interleukin-8 (IL-8). Primelwurzel hemmte die IL-8-Freisetzung dosisabhängig, während Thymian nur einen geringen Effekt zeigte. In Kombination war die hemmende Wirkung allerdings stärker als die Summe der Einzelextrakte.6 In einer neueren Veröffentlichung wurde die schleimlösende Wirkung von Schlüsselblumen-Extrakten an Mäusen durch Messung des Trachealausstoßes von Phenolrot ermittelt. Die höchste schleimlösende Wirkung wurde mit einem 40-prozentigen Ethanol-Extrakt aus Rhizomen mit Primelwurzeln erzielt. Diese Wirkung wurde in der Gruppe der Tiere beobachtet, denen der Extrakt in einer Dosis von 200 mg/kg verabreicht wurde (126,6 %). Ein Extrakt aus den Blättern der Schlüsselblume zeigte eine weniger ausgeprägte Wirkung, die bei einer Dosis von 200 mg/kg 74,5 % betrug.7
Antimikrobielle Effekte
Ältere In-vitro-Versuche zeigen antimikrobielle und antivirale Effekte. In einer erst kürzlich erschienenen Arbeit wurden die minimalen Hemmkonzentrationen (MHK) und minimalen bakteriziden Konzentrationen von Chloroform- und Methanolextrakten sowie einer saponinangereicherten Fraktion aus P. veris-Wurzeln bulgarischer Herkunft bestimmt. Die MHK-Werte lagen dabei zwischen 0,5 und 1 mg/ml. Zusätzlich wurde die Fähigkeit der getesteten Proben bewertet, die Biofilmbildung in Gegenwart von Sub-MHK-Konzentrationen zu hemmen. Dabei zeigte sich, dass alle getesteten Proben eine bessere Biofilmhemmung bei gramnegativen Stämmen aufwiesen. Die stärkste Wirkung wurde für den Chloroformextrakt gegen Pseudomonas aeruginosa beobachtet, während er zugleich die geringste Zytotoxizität gegenüber HaCaT-Zellen aufwies.8
Antivirale Wirkung
Um mögliche therapeutische Wirkungen von Extrakten aus Primelblüten auf die durch Influenzaviren induzierte Zytotoxizität zu identifizieren, wurden MDCK-Zellen mit H1N1 infiziert und anschließend in Gegenwart oder Abwesenheit von 25 bzw. 50 µg/ml Primelextrakt kulti-viert. Dabei konnte eine konzentrationsabhängige Abnahme der virusinduzierten Zelllyse um 50 % durch einen apolaren Chloroform-Blütenextrakt (50 µg/mL) erzielt werden. Oseltamivir (100 µg/ml) diente als Positivkontrolle zur Hemmung zytopathischer Effekte und führte zu einer > 96-prozentigen Verringerung der durch H1N1 vermittelten Zelllyse. Chemische Analysen identifizierten Terpene, Flavone, Tocopherole und weitere Phytochemikalien mit bekannten oder vermuteten antiviralen Eigenschaften, deren Wirkmechanismen in silico auf Signaltransduktion, Inflammasom- und Zelltodwege hinweisen.9
Kardioprotektive Eigenschaften
In einer 24-wöchigen Studie an Ratten mit chronischer Alkoholintoxikation zeigte ein eingedickter Flüssigextrakt oberirdischer Anteile von Primula veris (1:10, Auszugsmittel: Ethanol 70 Vol.-%) deutliche kardioprotektive Effekte. Der Extrakt verbesserte signifikant die Kontraktions- und Relaxationsfähigkeit des Myokards sowie hämodynamische Parameter und stabilisierte die mitochondriale Funktion durch höhere RCR-Werte. Histologisch zeigte sich eine Zunahme der Kardiomyozyten und eine Reduktion des interstitiellen Volumens.10
Antioxidative Effekte
Untersuchungen zur Primula veris L. zeigten, dass sowohl das verwendete Lösungsmittel als auch die genutzten Pflanzenteile entscheidend für die Extraktion bioaktiver Substanzen sind. Am reichsten an Polyphenolen erwiesen sich Blüten und Blätter, wobei heißes Wasser (frisches Material) und 70 % Ethanol (getrocknetes Material) die effizientesten Extraktionsmittel waren. Die gewonnenen Extrakte wiesen ein vielfältiges Polyphenolprofil und ein hohes antioxidatives Potenzial, das mit Methoden wie dem DPPH-Test und der Folin-Ciocalteu-Methode gemessen wurde, auf.11
Klinische Studien
Bisher liegen keine klinischen Humanstudien zu Einzelpräparaten vor; untersucht wurden ausschließlich Kombinationspräparate. Der spezifische Beitrag der Schlüsselblume zur Wirkung lässt sich nicht genau bestimmen.
In einer multizentrischen, randomisierten, doppelblinden Phase-IV-Studie mit 361 Patient:innen mit akuter Bronchitis zeigte die Kombination aus Thymian- (160 mg Trockenextrakt aus Thymiankraut (DEV 6–10:1, Auszugsmittel: Ethanol 70 Vol.%)) und Primelwurzelextrakt (60 mg Trockenextrakt aus Primelwurzel (DEV 6–7:1, Auszugsmittel: Ethanol 47,4 Vol.%)) beispielsweise über 11 Tage eine signifikant stärkere Reduktion der Hustenanfälle als Placebo (67,1 vs. 51,3 %; p < 0,0001). Eine Halbierung der Hustenanfälle wurde unter der Pflanzenkombination im Durchschnitt zwei Tage früher erreicht, und auch die Symptomverbesserung nach dem Bronchitis Severity Score verlief schneller und häufiger als unter Placebo. Die Behandlung war insgesamt gut verträglich, schwerwiegende Nebenwirkungen traten nicht auf.12
In einer weiteren doppelblinden, randomisierten, placebokontrollierten Multizenterstudie mit 150 Patient:innen wurde die Wirksamkeit und Verträglichkeit einer fixen Kombination aus Thymianfluidextrakt und Primelwurzeltinktur (Bronchicum® Tropfen, 5 × täglich 30 Tropfen) bei akuter Bronchitis untersucht. Der Bronchitis Severity Score sank in der Verumgruppe hochsignifikant stärker als unter Placebo, zudem waren am Studienende deutlich mehr Patient:innen symptomfrei (58,7 vs. 5,3 %). Die Behandlung wurde insgesamt sehr gut vertragen, schwerwiegende Nebenwirkungen traten nicht auf.13
In einer randomisierten, placebokontrollierten Studie mit 929 Patient:innen mit chronischer Rhinosinusitis wurde über 12 Wochen die Wirksamkeit und Sicherheit von zwei Dosierungen des pflanzlichen Präparats BNO 1016 (Sinupret extract®)(160,00 mg Trockenextrakt (3–6:1) aus Enzianwurzel, Schlüsselblumenblüten, Ampferkraut, Holunderblüten, Eisenkraut (1:3:3:3:3), Auszugsmittel: Ethanol 51 %) geprüft. Hinsichtlich des primären Endpunkts (Major Symptom Score nach 8 und 12 Wochen) zeigte sich keine Überlegenheit gegenüber Placebo, in sekundären Endpunkten jedoch ein Trend zugunsten des Präparats. Post-hoc-Analysen ergaben bei Patient:innen mit höherer Ausgangssymptomatik und längerem Krankheitsverlauf einen signifikanten Nutzen, während die Verträglichkeit insgesamt sehr gut war.14
Wissenschaftlich bewertete Anwendungen
Das HMPC bewertete Schlüsselblumenblüten und Primelwurzel bisher als traditionelle pflanzliche Arzneimittel und empfiehlt ihre Anwendung aufgrund langjähriger Erfahrung als schleimlösende Mittel bei erkältungsbedingtem Husten.
Typische Zubereitungen, Tagesdosierung und Anwendungsdauer
Primelwurzel kann als Trocken-, Flüssig- oder Dickextrakt, in Form einer Tinktur oder als Tee angewendet werden; Schlüsselblumenblüten vor allem als Flüssigextrakt oder Tee. Für die Zubereitung eines Tees aus der Primelwurzel werden 0,2–0,5 g der zerkleinerten Droge mit 150 ml kochendem Wasser übergossen, wovon bis zu drei Tassen täglich getrunken werden können. Bei den Blüten beträgt die Dosierung 1 g zerkleinerte Droge auf 150 ml kochendes Wasser, ebenfalls bis zu dreimal täglich. Bessern sich die Beschwerden innerhalb einer Woche nicht oder verschlimmern sie sich, sollte ärztlicher Rat eingeholt werden.
Kinder, Schwangere und Stillende
Das HMPC empfiehlt aufgrund fehlender Studien die Verwendung von Primelwurzel ab 4 Jahren, Schlüsselblumenblüten sogar erst ab 12 Jahren. Schwangeren und stillenden Frauen kann aufgrund fehlender Daten die Anwendung nicht empfohlen werden.
Wechsel- & Nebenwirkungen (Risiken)
Bei Patient:innen mit Gastritis oder Magengeschwür ist Vorsicht geboten. Es können allergische Reaktionen auftreten, die Häufigkeit dieser Nebenwirkung ist allerdings nicht bekannt. Eine Überdosierung kann Magenbeschwerden, Erbrechen oder Durchfall verursachen.15
Kontraindikation
Bei einer bekannten Hypersensitivität gegenüber einer in Schlüsselblume enthaltenen Substanz.