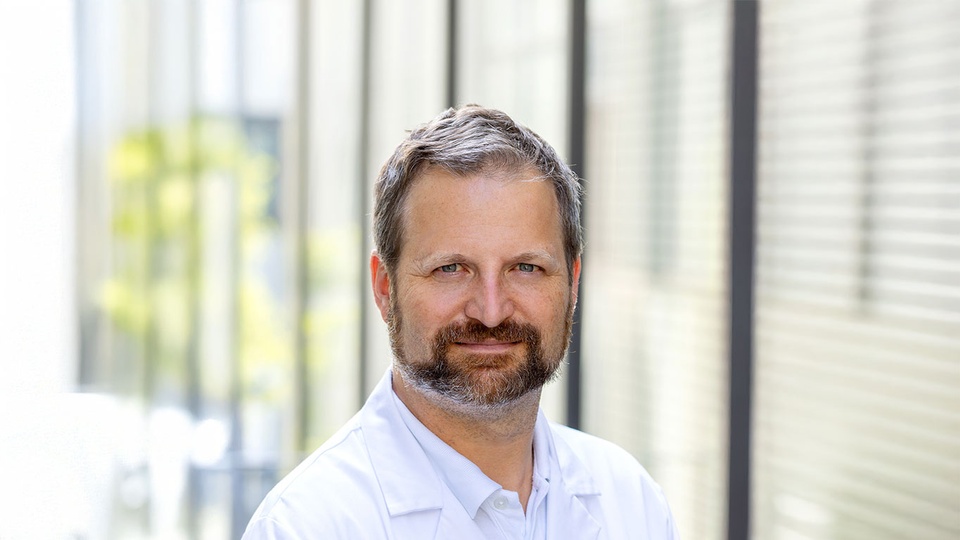
Epidemiologie und Prävention
Lungenkrebs ist in Österreich die zweithäufigste Krebserkrankung, zugleich jedoch die mit der höchsten Sterblichkeit – vor allem bei Menschen im Alter zwischen 40 und 70 Jahren. Während Österreich in Diagnostik und Therapie sehr gut ist, besteht gegenüber Ländern wie den USA oder Schweden deutlicher Aufholbedarf bei Nichtraucherschutz und Früherkennung.
Rauchen ist der dominierende Risikofaktor – eine bloße Reduktion reicht nicht aus. Hochmair illustrierte dies pointiert: Wenn jemand von 20 auf 10 Zigaretten am Tag reduziere, sei das im Prinzip „dasselbe“ – entscheidend sei der komplette Rauchstopp. Auch sogenannte „leichte“ Filterzigaretten sind problematisch, da sie zu tieferer Inhalation führen und die Häufigkeit peripherer Adenokarzinome erhöht haben. Etwa 15% der Lungenkrebspatient:innen sind allerdings Nie‑Raucher; hier spielen Passivrauchen, berufliche Exposition (z.B. Asbest) und weitere seltenere Faktoren eine Rolle.
Rolle der Tabakentwöhnung
Gerade Apothekerinnen und Apotheker haben eine Schlüsselrolle in der Ansprache zum Rauchstopp. Hochmair betonte, man dürfe nicht müde werden, auch bei bereits Erkrankten zum Aufhören zu motivieren, da ein Rauchstopp zum Zeitpunkt der Diagnose das Überleben im Mittel um rund 1,3 Jahre verlängern kann – ein Effekt, den viele Patient:innen eher einem „Wundermedikament“ als einem Verhaltenswechsel zutrauen würden.
Ebenso wichtig ist die Vorbildwirkung des Gesundheitspersonals: Rauchende Mitarbeitende unmittelbar vor Krankenhaus- oder Schulgebäuden unterminieren jede Präventionsbotschaft.
Diagnostikpfad und Stadien
Viele Lungenkarzinome werden spät entdeckt, weil die Lunge selbst nicht schmerzt und es keine wirklich typischen Beschwerden gibt. Häufig findet sich der Tumor als Zufallsbefund im Röntgen oder CT, etwa im Rahmen einer OP‑Freigabe. Klassische Alarmsymptome sind ein veränderter Hustencharakter oder Hämoptysen, doch liegen diese meist bereits im fortgeschrittenen Stadium vor.
Der typische Weg führt vom Hausarzt zur fachärztlichen Abklärung mit CT, Bronchoskopie und Biopsie und schließlich zur interdisziplinären Therapieentscheidung im Spital. Österreich ist hier laut Hochmair extrem schnell und qualitativ sehr gut, das Hauptproblem bleibt aber die spätee Diagnose in fortgeschrittenen Stadien.
Von der „einen“ Chemo zur personalisierten Therapie
Noch vor 20 Jahren galt das fortgeschrittene Lungenkarzinom als nahezu hoffnungslos, die Standardantwort war eine unspezifische Chemotherapie - mit begrenztem Überlebensvorteil. Mit der Immuntherapie änderte sich dies grundlegend: Bei Patient:innen mit hoher PD‑L1‑Expression lebt etwa ein Drittel nach fünf Jahren noch, ein Ergebnis, das man laut Hochmair „beim Lungenkarzinom im Stadium IV in keinster Weise jemals gesehen“ habe. Heute ist klar: „Es gibt nicht mehr den einen Lungenkrebs“, sondern zahlreiche Subtypen, die molekular unterschiedlich geprägt sind. Die enge Kooperation mit der Pathologie ist zentral: Nur über ein konsequentes molekulares Profiling (u.a. EGFR, ALK, KRAS, NTRK, weitere Treibermutationen) lässt sich entscheiden, ob eine Immuntherapie, eine zielgerichtete Therapie oder eine Kombination sinnvoll ist. Hochmair formulierte es drastisch: „Ohne Pathologie kann ich keine Entscheidung für den/die Patienten/Patientin treffen.“
Nach Jahrzehnten geringer Fortschritte zeigen moderne Konzepte insbesondere im frühen und lokal fortgeschrittenen Stadium sehr beeindruckende Effekte:
• Chemotherapie: Greift vor allem schnell proliferierende Zellen an und bleibt in vielen Stadien Bestandteil der Kombinationstherapie.
• Immuncheckpoint-Inhibition (z.B. Pembrolizumab, Nivolumab, Durvalumab): Blockiert PD‑1/PD‑L1‑Signalwege und reaktiviert das Immunsystem, das den Tumor wieder als „böse Zelle“ erkennt.
• Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKI, z.B. Osimertinib, Afatinib, Lorlatinib, Alectinib): Wirken intrazellulär an Wachstumsrezeptoren und sind bei passenden Mutationen (z.B. EGFR, ALK) hoch effektiv, führen aber meist zu Tumorstabilisierung statt vollständiger Heilung.
• Bispezifische Antikörper: Sie können zwei unterschiedliche Antigene oder Epitope gleichzeitig binden und so parallel zwei Signalwege im Tumor oder im Tumormikromilieu blockieren. Derzeit vor allem in klinischen Studien, mit potenziell wachsender Bedeutung in den nächsten Jahren.
• Antikörper‑Wirkstoff‑Konjugate (ADCs, z.B. Trastuzumab‑Deruxtecan, Patritumab‑Deruxtecan): „Neueste Form der zielgerichteten Chemotherapie“, bei der ein Zytostatikum kovalent an einen Antikörper gekoppelt wird, um die Substanz selektiv in die Tumorzelle zu bringen.
Immunbedingte Nebenwirkungen
Typische Nebenwirkungen einer Immuntherapie können fast jedes Organ betreffen – die meist verbreiteten Nebenwirkungen sind:
• endokrinologische Störungen (v.a. Schilddrüsenüber- oder -unterfunktion)
• Hautreaktionen und Exantheme
• Hepatitis mit Transaminasenerhöhung
• Pneumonitis (nichtinfektiöse Lungenentzündung)
• Diarrhö bzw. Kolitis
• selten Myokarditis oder pankreatitisbedingter Diabetes
Der Schweregrad wird von Grad 1 bis Grad 4 eingeteilt; ab Grad 3 wird eine Fortführung der Immuntherapie in der Regel nicht mehr empfohlen. Die entscheidende Akutmaßnahme bei klinisch relevanten immunvermittelten Toxizitäten ist systemisches Kortison, meist über mehrere Wochen mit langsamem Ausschleichen, in schweren Fällen bis zu drei Monaten. Bemerkenswert ist die prognostische Bedeutung: Patient:innen mit immunvermittelten Nebenwirkungen haben tendenziell ein besseres Überleben.
Für die Praxis wichtig
Unter Immuntherapie kann es initial zu einer Größenzunahme des Tumors kommen, bevor ein Rückgang einsetzt – die sogenannte Pseudoprogression. Ursache ist die massive Infiltration durch Immunzellen und damit ein temporäres Anschwellen der Läsion. CT‑Berichte unter Immuntherapie sind also mit Vorsicht zu interpretieren.
Zeitpunkt der Infusion – eine überraschende Variable
Eine beim ASCO vorgestellte Studie verglich Chemo‑Immuntherapie, die vor bzw. nach 15 Uhr verabreicht wurde – mit einem überraschend „dramatischen Unterschied“ zugunsten der Behandlungen, die vor 15 Uhr abgeschlossen waren (besseres progressionsfreies und Gesamtüberleben). Dies weist auf eine mögliche Relevanz circadianer Rhythmen („Chronotherapie“) hin. Für die Praxis vieler Ambulanzen und Tageskliniken – die ohnehin vor dem späten Nachmittag infundieren – bedeutet das, dass sie unbewusst bereits „state of the art“ handeln.
Fazit
Zusammenfassend zeigt der Vortrag, dass die Therapie des Lungenkarzinoms „viel individualisierter“ geworden ist und nur in einem gut vernetzten Team aus Onkologie, Pathologie, Pflege – und Apotheke – ihr volles Potenzial entfalten kann.





