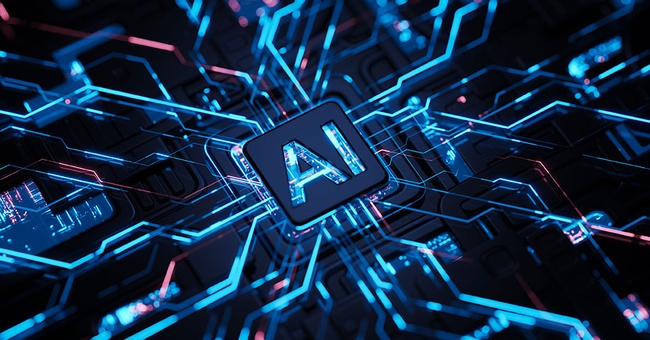Wie weit verbreitete stereotype Anschauung, dass es sich bei Vitiligo lediglich um eine symptom- und harmlose Pigmentstörung handelt, weicht allmählich einer zeitgemäßen, differenzierten Betrachtungsweise, welche auch die oft erheblichen psychosozialen Auswirkungen dieser Erkrankung berücksichtigt und in ein ganzheitliches Behandlungskonzept einschließt.
Obwohl Vitiligo seit Jahrtausenden bekannt und keine seltene Hauterkrankung ist, wurde diesem Krankheitsbild bis vor Kurzem kaum Bedeutung beigemessen. Dies ist insofern paradox, als Vitiligo eine optisch sehr augenscheinliche und somit potenziell stigmatisierende Erkrankung ist, deren Folgen auf die Lebensqualität betroffener Menschen erheblich sein können, was in der Vergangenheit weithin unterschätzt und/oder bagatellisiert wurde. Ebenso hartnäckig wie die Ausblendung der psychischen Dimension dieser Erkrankung hielt sich auch der Mythos, dass Vitiligo nicht behandelbar sei, was viele Patient:innen entweder zur Resignation oder Anwendung von frei käuflichen Präparaten oder alternativen Interventionen ohne Wirknachweis veranlasste. In dieser Situation markierte die Zulassung des topischen JAK-Inhibitors Ruxolitinib, der sich in groß angelegten Phase-III-Studien als wirksam bei der Behandlung der Vitiligo erwiesen hat, sowohl therapeutisch als auch in der allgemeinen Wahrnehmung den Beginn einer neuen Ära in der langen Geschichte dieser Hauterkrankung.
Häufigkeit
Die Daten zur Häufigkeit von Vitiligo schwanken je nach Methode zur Erfassung der Prävalenz (Online-Befragung, Auswertung von Versicherungsdaten, Telefoninterviews, körperliche Untersuchung) und geographischer Lokalisation bzw. ethnischer Zugehörigkeit der untersuchten Bevölkerungsgruppen. Rezente Studien liefern für den europäischen Bereich relativ nahe beieinander liegende Ergebnisse, die von einer Prävalenz zwischen 0,4–0,8 % ausgehen. Hervorzuheben ist eine deutsche Studie, die auf der dermatologischen Untersuchung von mehr als 121.000 Mitarbeiter:innen im Alter zwischen 16–70 Jahren von großen deutschen Unternehmen beruht. In dieser großangelegten Studie wurde eine Prävalenz von 0,77 % festgestellt.20 Umgelegt auf die Gesamtbevölkerung entspricht dies einer Anzahl von ca. 650.000 betroffenen Menschen in Deutschland und 70.000 betroffenen Menschen in Österreich. Daten aus rezenten Studien aus Europa, Amerika und Korea deuten weiters darauf hin, dass die Prävalenz in den letzten 20 Jahren zunimmt, was auf bisher noch nicht exakt identifizierte Umwelt- und Lifestyle-Einflüsse zurückgeführt wird.17,24
Klinik und Diagnostik
Vitiligo ist bei charakteristischer Ausprägung leicht klinisch zu diagnostizieren. Es ist eine auffällige, aber fast immer völlig symptomlose Hauterkrankung. Erkrankte Patient:innen weisen regelmäßig konfigurierte, rundliche oder ovale Hautareale auf, die sich aufgrund des Pigmentverlustes deutlich von gesunder Haut durch die weißliche Hautfarbe abgrenzen lassen. In den Vitiligo-Arealen können auch dieKörperhaare depigmentiert sein, was als Leukotrichie bezeichnet wird und mit einem schlechteren therapeutischen Ansprechen einhergeht. Ein Befall der Lippen oder der anogenitalen Schleimhaut ist nicht selten zu beobachten. Abgesehen von der farblichen Abweichung weist die befallene Haut eine völlig normale Textur ohne Entzündungszeichen wie Rötung, Verdickung oder oberflächliche Schuppung auf. In seltenen Fällen sieht man bei starker Krankheitsaktivität an den Rändern von Vitiligo-Herden einen entzündlichen Randsaum oder eine Übergangszone mit unvollständiger Depigmentierung der Haut (hypochrome Ränder). Weitere Zeichen von Aktivität sind die Entstehung von kleinen, Konfetti-artigen Depigmentierungen oder das Auftreten von Vitiligo in traumatisierten oder stark mechanisch beanspruchten Körperarealen, was als Köbner-Phänomen bezeichnet wird. Die Ausdehnung der Erkrankung kann stark variieren und von einzelnen depigmentierten Hautstellen bis hin zu einer fast völligen Depigmentierung des gesamten Integuments reichen. Wie bei anderen Dermatosen gibt es auch vitiligospezifische Prädilektionsstellen. Häufig zeigt sich ein Befall des Gesichtes, der Akren (Hände und Füße), der Extremitäten mit Bevorzugung der Druckstellen (Ellbogen und Knie) sowie des Anogenitalbereiches. Etwas gehäuft findet man bei Vitiligo-Patient:innen auch melanozytäre Nävi mit einem weißen Hof (Halo-Nävi).

Bei der Klassifikation der Vitiligo werden drei Typen und Unterformen unterschieden: die nicht-segmentale Vitiligo , die segmentale Vitiligo und die nicht klassifizierbare Vitiligo.10 Die korrekte Zuordnung einer neu auftretenden Vitiligo spielt bei der Patientenbetreuung eine große Rolle, da der Vitiligo-Typ sowohl prognostische als auch diagnostische und therapeutische Implikationen hatIm typischen Fall ist Vitiligo eine klinische Blickdiagnose, allerdings kann die Abgrenzung zu anderen mit Pigmentstörungen einhergehenden Hautkrankheiten in Einzelfällen eine differenzialdiagnostische Herausforderung darstellen.5 Als diagnostische Hilfsmittel können dabei die Betrachtung der Haut in einem abgedunkelten Raum mit Blaulicht (Wood-Licht-Untersuchung) und die Auflichtmikroskopie herangezogen werden. Eine Hautbiopsie zur histopathologischen Untersuchung ist selten erforderlich.
| Einteilung der Vitiligo | |
| Vitiligo-Typ | Charakteristika |
| Nicht-segmentale Vitiligo (NSV) | Häufigster Vitiligo-Typ (85–90 %) Zumeist symmetrische Verteilung mit variablem Körperoberflächenbefall Leukotrichie seltenVerlauf unterschiedlich und nicht vorhersagbar Häufig assoziiert mit anderen autoimmunologischen Erkrankungen Therapieergebnisse abhängig von Lokalisation (Gesicht >> Hände/Füße) |
| Segmentale Vitiligo (SV) | Bevorzugtes Auftreten im Kindes- und Jugendalter Zumeist beschränkt auf ein unilaterales Körpersegment Leukotrichie häufig Lokalisierte Ausbreitung über 12 (bis 24) Monate, danach Stillstand Bleibt üblicherweise lokalisiert Selten assoziiert mit anderen autoimmunologischen Erkrankungen Therapieergebnisse von konservativen Maßnahmen oft unbefriedigend |
| Nicht klassifizierbare Vitiligo | Singuläre kutane oder mukosale Läsion Nachkontrollen zur weiteren Zuordnung erforderlich |
Eine laborchemische Blutuntersuchung ist zur Diagnose einer Vitiligo nicht geeignet, wird jedoch zum Screening auf Komorbiditäten durchgeführt, da Vitiligo genetisch mit anderen Autoimmunerkrankungen wie autoimmunen Schilddrüsenerkrankungen (insbesondere Hashimoto-Thyreoiditis), rheumatoider Arthritis, entzündlichen Darmerkrankungen u. a. m. assoziiert ist. Daher muss bei jeder Erstuntersuchung eine detaillierte allgemeine Anamnese erhoben werden. Bei leerer Anamnese werden laborchemisch lediglich TSH und die Schilddrüsen-Autoantikörper bestimmt, da eine Autoimmunthyreoiditis initial oft klinisch latent ist. Lediglich bei Hinweisen auf das zusätzliche Vorliegen anderer Erkrankungen werden weitere diagnostische Maßnahmen gesetzt.
Entgegen der oft geäußerten Befürchtung, dass Vitiligo mit einer erhöhten Hautkrebsgefahr einhergeht, zeigen mehrere große Studien, dass das Hautkrebsrisiko bei Vitiligo-Patient:innen verringert ist. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass das aktivierte Immunsystem bei diesen Personen mit einer erhöhten Immunüberwachung einhergeht, welche entstehende Krebszellen früher und effizienter abwehrt.9,12

Vitiligo (Weißfleckenkrankheit) ist eine autoimmunologische Hauterkrankung, bei der autoreaktive T-Lymphozyten die pigmentbildenden Zellen der Haut (Melanozyten) attackieren und zerstören, was klinisch als scharf begrenzte, depigmentierte, weißlich erscheinende Hautareale imponiert.
Psychosoziale Aspekte der Vitiligo
Die WHO-Definition von Gesundheit versteht diese als einen Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und psychosozialen Wohlbefindens. Daher ist es kaum verständlich, dass sich die wissenschaftliche Literatur erst in den letzten Jahren intensiver mit den Auswirkungen von Vitiligo auf Lebensqualität, Psyche und soziale Beziehungen auseinandergesetzt hat. Mittlerweile liegen großangelegte Studien vor, die belegen, wie mannigfaltig und grundlegend Vitiligo das Leben betroffener Patient:innen prägen kann.11,20 Neben einer signifikanten Beeinträchtigung der Lebensqualität wurde bei Vitiligopatient:innen im Vergleich zu Kontrollgruppen ein erhöhtes Auftreten von Depressionen und Angst, Gefühl der Stigmatisierung, vermindertes Selbstwertgefühl, Schlafstörungen, Beziehungsprobleme, soziales Rückzugsverhalten u. v. m. beschrieben, was auf die enorme Bedeutung eines ganzheitlichen Verständnisses dieser Erkrankung hinweist. Der Einfluss der Erkrankung auf die Lebensqualität ist jedoch individuell sehr unterschiedlich und von vielen Variablen abhängig. Seitens der Erkrankung korrelieren die Ausdehnung der Vitiligo, der Befall sichtbarer Körperareale (Gesicht, Hände) oder des Genitalbereiches, eine längere Erkrankungsdauer und ein dunkler Hautphototyp mit einer höheren Krankheitslast. Soziodemographische Merkmale, die mit einem erhöhten Leidensdruck einhergehen, sind jüngeres Alter, weibliches Geschlecht, Partnerlosigkeit und niedrigerer Bildungsstatus. Besonders bei Kindern ist es enorm wichtig, zu evaluieren, ob die Erkrankung den Lebensalltag beeinflusst. Während eine Pigmentstörung bei Kleinkindern ohne psychosoziale Bedeutung ist, kann es bei älteren Kindern durch abschätzige oder beleidigende Kommentare von Gleichaltrigen zu einer ernstzunehmenden psychischen Belastung kommen, die möglichst früh erfasst und aufgearbeitet werden sollte.

• Vitiligo ist eine relativ häufige autoimmunologische Hauterkrankung.
• Die Prävalenz in Europa liegt zwischen 0,4–0,8 %.
• Das klinische Bild wird durch die Ausdehnung und das Verteilungsmuster der depigmentierten Hautareale geprägt.
• Die deutliche Sichtbarkeit der Hauter-krankung kann zu einer Stigmatisierung und erheblichen psychosozialen Beeinträchtigungen führen.
• Pathophysiologisches Korrelat der depigmentierten Haut ist die Zerstörung der pigmentbildenden Zellen durch autoreaktive zytotoxische T-Zellen.
• Interferon-γ ist ein zentraler Mediator in der Pathogenese der Vitiligo.
• Der topische JAK-Inhibitor Ruxolitinib inhibiert die Wirkung von Interferon-γ und ist in Europa seit 2023 als erstes Arzneimittel zur spezifischen Behandlung der Vitiligo zugelassen.
Pathogenese
Die Aufschlüsselung der Vitiligo-Pathogenese ist mittlerweile weit fortgeschritten und hat wesentliche Erkenntnisse gebracht, welche nicht nur zu einem besseren Verständnis der komplexen genetischen, immunologischen und biochemischen Zusammenhänge geführt haben, sondern auch die Grundlage für die Entwicklung neuer therapeutischer Ansätze bilden.2;13 Das histopathologische Korrelat der depigmentierten Hautareale ist eine Einwanderung von zytotoxischen CD8+-T-Lymphozyten in die Haut, die zu einem Untergang der pigmentbildenden Melanozyten führt. Während die Melanozyten in der Epidermis (Oberhaut) im Rahmen des Entzündungsprozesses zerstört werden, bleiben melanozytäre Stammzellen in den Körper- und Kopfhaarfollikeln üblicherweise von der immunologischen Attacke verschont. Somit kann bei einer erfolgreichen Behandlung des zugrunde liegenden Entzündungsprozesses eine Repigmentierung einerseits vom gesunden Rand betroffener Hautareale (periphere Repigmentierung), andererseits auch durch die Aktivierung (zum Beispiel durch Lichttherapie) der intakten melanozytären Vorläuferzellen in den Haarfollikeln ausgehen. Die pathophysiologischen Abläufe sind komplex reguliert, wobei neben Zellen des adaptiven und angeborenen Immunsystems auch Zytokine und Chemokine involviert sind, welche die Kommunikation zwischen den am Entzündungsprozess beteiligten Zellen herstellen. Ein zentrales Zytokin in der Pathogenese der Vitiligo ist das von den aktivierten CD8+-T-Zellen produzierte Interferon-γ, das über den JAK-STAT-Signaltransduktionsweg proinflammatorische Signale an den Zellkern weitergibt, die den Entzündungsprozess aufrechterhalten.3 In der Zwischenzeit gibt es zahlreiche topische und systemische JAK-Inhibitoren, welche die Wirkung von Interferon-γ blockieren können. Mit der Zulassung des topischen JAK-Inhibitors Ruxolitinib haben sich somit völlig neue therapeutische Perspektiven bei der Behandlung der Vitiligo eröffnet.
Über lange Zeit zählte Vitiligo zu den therapeutisch am meisten vernachlässigten Krankheitsbildern in der Dermatologie. Nicht nur unter Laien, sondern auch unter Ärzt:innen war die Anschauung weit verbreitet, dass es keine wirksamen Therapien für diese Erkrankung gäbe. In einem vom Komitee der Internationalen Vitiligo Patienten Organisation VIPOC (Vitiligo International Patient Organizations Committee) im Jahr 2024 herausgegebenen Vitiligo-Weißbuch, das auf europäischer Ebene zu einer verbesserten Diagnostik und einem aktiveren Management von Vitiligo-Patient:innen beitragen soll, wurde u. a. hervorgehoben, dass 84 % der Patient:innen in Frankreich zum Zeitpunkt einer rezenten Umfrage ohne Therapie waren.29 Ein ähnlicher Prozentsatz ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch für andere europäische Länder anzunehmen und reflektiert den vielerorts vorherrschenden therapeutischen Nihilismus bei Vitiligo. Obgleich Vitiligo nur selten komplett heilbar ist, kann in vielen Fällen lokalisationsabhängig eine teilweise bis weitgehende oder komplette Repigmentierung der Haut erzielt werden, was für die Patient:innen mit einer keinesfalls zu unterschätzenden Verbesserung ihrer Lebensqualität einhergeht.
Die aktuellen therapeutischen Möglichkeiten in der Vitiligo-Behandlung werden in Teil 2 in der kommenden Ausgabe thematisiert.
Dieser Artikel wurde als Kooperationsprojekt zwischen der Medizinischen Monatsschrift für Pharmazeuten (Deutscher Apotheker Verlag, Stuttgart) und der Österreichischen Apotheker-
Zeitung (APOVERLAG, Wien) realisiert.
Quellen
1 Bae JM, et al.: Phototherapy for vitiligo: a systematic review and meta-analysis. JAMA Dermatol 2017; 153: 666-674
2 Bergqvist C, et al.: Vitiligo: A focus on pathogenesis and its therapeutic implications. J Dermatol 2021; 48: 252-270
3 Bertolotti A, et al.: Type I interferon signature in the initiation of the immune response in vitiligo. Pigment Cell Melanoma Res 2014; 27: 398-407
4 Böhm M, et al.: S1-Leitlinie: Diagnostik und Therapie der Vitiligo. .J Dtsch Dermatol Ges 2022; 20: 365-379
5 Böhm M, Tanew A. Vitiligo. J Dtsch Dermatol Ges 2025; 23: 968-987
Weitere Literatur auf Anfrage