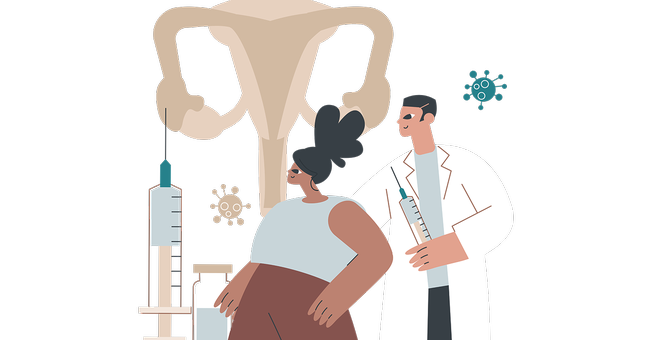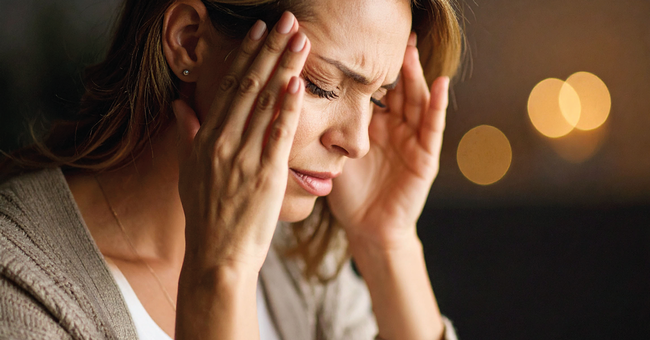Acne vulgaris bezeichnet eine chronisch-entzündliche Erkrankung der Haartalgdrüseneinheit der Haut, bestehend aus Haarfollikel, Haarschaft und Talgdrüse. Im Zuge der Akneentstehung verstopfen Talg und verhornte Hautbestandteile eine normale Hautpore, wodurch zunächst Mikrokomedonen entstehen. Es kommt zur Besiedlung durch Cutibacterium acnes (früher Propionibacterium acnes) und damit zur Bildung eines geschlossenen Komedons („Whitehead“), dessen Follikelausgang sich bei weiterer Ablagerung von Talg und Hornmaterial öffnet. Im offenen Zustand wird der Komedon aufgrund seiner schwarzen Farbe, die auf die Oxidation von Lipiden und das Hautpigment Melanin zurückzuführen ist, auch „Blackhead“ genannt. Dehnt sich der Komedon weiter aus, reißt der Follikel und es entstehen entzündliche Läsionen, worunter Akne verstanden wird. Zu den wichtigsten Mechanismen, die an der Pathogenese der Acne vulgaris beteiligt sind, zählen somit eine gesteigerte Talgdrüsenaktivität und damit eine übermäßige Talgproduktion (Hyperseborrhö) sowie Veränderungen der Fettsäurezusammensetzung des Talgs und eine verstärkte follikuläre Verhornung (Hyperkeratinisierung). Auch Funktionsstörungen der angeborenen und adaptiven Immunantwort können eine Rolle bei der Entstehung von Akne spielen.
Systemisches und lokales Hormonungleichgewicht bei Akne
Endogene Hormone spielen eine zentrale Rolle in der Entstehung von Akne. Bei Frauen wurden in Studien erhöhte Spiegel von Androstendion und Testosteron festgestellt, während hohe Östradiolwerte einen schützenden Effekt zeigten. In der Pubertät fördern erhöhte Androgenspiegel häufig Akne. Bei Männern korrelieren erhöhte 17α-Hydroxyprogesteron-Werte mit stärkerer Akne. Auch eine lokale Überproduktion von Testosteron und 5α-Dihydrotestosteron steigert die Talgdrüsenaktivität. Zudem sind Insulinresistenz, Hyperinsulinämie und hohe IGF-1-Werte positiv mit der Akneausprägung assoziiert.
Das Haut-Exposom
Familienstudien haben das Bestehen einer genetischen Prädisposition für Acne vulgaris gezeigt. Neben der familiären Disposition spielt im Zusammenhang mit Akne das sogenannte Haut-Exposom eine erhebliche Rolle. Das Konzept des Haut-Exposoms beschreibt den Einfluss aller Lebensstil- und Umweltfaktoren auf die Gesundheit oder Krankheit der Haut. Bedeutende Elemente des Exposoms sind unter anderem eine unausgewogene Ernährung, Stress und Schlafmangel bis hin zu Sonnenexposition, Umweltverschmutzung und minderwertigen oder nicht passend gewählten Kosmetikprodukten.
Ernährung
Die Ernährung beeinflusst nachweislich die Entstehung von Hyperseborrhö und damit die Entwicklung von Acne vulgaris. Mehrere Studien zeigen einen signifikanten Zusammenhang zwischen einem erhöhten Konsum von Milch, Milchprodukten und Molkeproteinen und der Exazerbation von Akne.
Zudem sollten Lebensmittel mit hoher glykämischer Last vermieden werden, da sie über die Aktivierung des mTORC1-Signalwegs die Sebumproduktion steigern und so zur Pathogenese und Verschlechterung der Akne beitragen können. Eine Reduktion dieser Nahrungsmittel ist mit einer klinischen Verbesserung des Hautbildes assoziiert. Stattdessen sollte bei Akne auf eine mediterrane Ernährung mit ausreichend Obst und Gemüse und moderatem Konsum an hyperglykämischen Lebensmitteln und Kohlenhydraten, gesättigten Fettsäuren und Schokolade geachtet werden.

Die Bedeutung der Darm-Haut-Achse
Eine Vielzahl von Studien hat zudem eine Wechselwirkung zwischen der Darmmikrobiota und der Hauthomöostase gezeigt. Diese Kommunikation zwischen den die Darmflora bildenden Mikroorganismen und der Haut wird vor allem durch Beeinflussung und Veränderung des Immunsystems erreicht und deutet darauf hin, dass durch Modulation des intestinalen Mikrobioms auch der Verlauf von Akne beeinflusst werden kann. In diesem Kontext haben topische und insbesondere oral verabreichte Probiotika in In-vitro-Studien positive Wirkungen gezeigt. Topische Probiotika wirken, indem sie das Hautmikrobiom ausgleichen, oral verabreichte Probiotika wiederum modulieren die Zusammensetzung der Darmmikrobiota, haben entzündungshemmende Effekte und stellen die Darmbarriere über metabolische Signalwege unter Beteiligung von IGF-1 wieder her. Probiotika sollten daher weiterhin als Therapieoption der Akne untersucht und in Betracht gezogen werden, sowohl als potenzielle Alternative als auch als adjuvante Maßnahme zu bestehenden Standardbehandlungen. Aktuell gelten hauptsächlich Lactobacillus und Bifidobacterium als effektiv wirksame Mikroorganismen zur Prävention und Behandlung der Akne.
Stress, Schlafmangel und mentale Gesundheit
Akne kann die psychische Gesundheit erheblich beeinträchtigen und ist häufig mit vermindertem Selbstwertgefühl, Körperbildstörungen, Angst und Depression assoziiert. Umgekehrt kann psychischer Stress die Akneentwicklung fördern oder bestehende Symptome verschlimmern. Dabei spielt das Corticotropin-Releasing-Hormon (CRH), das in talgdrüsenreicher Haut verstärkt exprimiert wird, eine zentrale Rolle. Auch Schlafmangel wirkt als intrinsischer Stressor, der über inflammatorische Prozesse und eine gestörte Talgregulation zur Exazerbation der Akne beitragen kann.
Sonnenexposition – kein Heilmittel bei Akne
Sonnenlicht und UV-Strahlen gelten häufig noch heute fälschlicherweise als wirksame Aknetherapie und werden entsprechend von Patient:innen eingesetzt. Dieser Irrglaube ist allerdings nicht ungefährlich, da die Sonnenexposition einige schädliche Konsequenzen mit sich bringen kann. Neben photokarzinogenen Effekten und potenzieller Verschlimmerung der Akne beschleunigt UV-Strahlung die Hautalterung und fördert, insbesondere bei entzündlichen oder durch Drücken oder Kratzen manipulierten Akneläsionen, postinflammatorische Hyperpigmentierung und damit die Entstehung der sogenannten Pickelmale. Darüber hinaus erhöhen einige Aknetherapien, beispielsweise die orale Doxycyclin- oder Isotretinoin-Therapie oder die topische Anwendung von Retinoiden oder Benzoylperoxid, die Empfindlichkeit der Haut gegenüber UV-Strahlung, weshalb in diesen Fällen ganz besonders auf intensiven Sonnenschutz geachtet werden sollte. Expert:innen empfehlen bei Akne die tägliche Verwendung von Breitband-Sonnenschutzmitteln mit Lichtschutzfaktor ≥ 30 sowie die Abschirmung gegenüber sichtbarem Licht durch Schatten, Sonnenhüte und geeignete Kleidung oder auch Sonnenschutzmittel mit Titanoxid und pigmentierten Eisenoxiden. Breitband-UV-Schutzmittel können zusätzlich zur Photoprotektion die Hautbarriere stärken, den transepidermalen Wasserverlust verringern, vor Umweltverschmutzung schützen und wirken je nach Formulierung talgregulierend, entzündungshemmend und antioxidativ.

Weitere Einflussfaktoren:
Von Umweltverschmutzung bis Hautpflege
Zu den exogenen Faktoren, die Akne begünstigen können, zählen Luftverschmutzung und Rauchen – Umweltpartikel wie Staub, Tabakrauch oder Pollen fördern inflammatorische Prozesse in der Haut. Auch bestimmte Medikamente, z. B. Lithium, Corticosteroide, anabole Steroide und Progestagen-haltige
Kontrazeptiva sowie Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamin B6/B12, Molkenprotein, Iod, Kreatin und Carnitin, stehen im Verdacht, Akne zu verschlechtern.
Die Hautpflege spielt eine zentrale Rolle im Management: In Studien zeigte eine milde, regelmäßige Gesichtsreinigung eine signifikante Verbesserung bei milder bis moderater Akne. Wichtig ist die Verwendung nicht-komedogener Produkte, die die Barrierefunktion nicht zusätzlich beeinträchtigen. Eine adäquate Feuchtigkeitsversorgung sollte Teil jeder Aknetherapie sein, um Irritationen und Verschlechterungen des Hautbilds zu vermeiden.
Therapieoptionen bei Akne
Primäre Ziele der Akne-Therapie sind Kontrolle und Linderung bestehender Akneläsionen, die Prävention dauerhafter Narbenbildung sowie die Verringerung der Krankheitslast. Es sind sowohl topische als auch systemische Therapien gebräuchlich, die je nach Schweregrad der Akne und generellem Gesundheitszustand der Patient:innen ausgewählt werden. Häufig erweisen sich Kombinationstherapien als erfolgreich, da dadurch auf mehrere Mechanismen der Akneentstehung abgezielt werden kann.
Topische Therapie
Topische Behandlungsformen haben den Vorteil einer geringen systemischen Belastung, sind allerdings häufig mit lokalen Hautirritationen verbunden.
Topische Retinoide
Vitamin-A-Derivate, die sogenannten Retinoide, darunter Adapalen und Tretinoin in Arzneimitteln oder Retinol, Retinaldehyd und Retinylpalmitat in Kosmetika, sind häufig eingesetzte Wirkstoffe zur äußeren Behandlung der Akne sowie zur Reduktion und Vorbeugung von Hautalterungserscheinungen. Retinoide zeigen komedolytische, antiinflammatorische Wirkung und vermindern Hyperpigmentierung, allerdings sollten Patient:innen darauf hingewiesen werden, dass es in den ersten Wochen häufig zu einer Verschlechterung der Akne kommt, bevor dann die tatsächliche Besserung eintritt.
Weitere Nebenwirkungen können Trockenheit, Schuppen und Rötung der Haut sein. Diesen kann zum Teil durch eine sanfte, feuchtigkeitsspendende Hautpflege und Sonnenschutz entgegengewirkt werden, was die Therapie topischer Retinoide allerdings einschränken kann. Werden Retinoide von der Haut gut toleriert, eignen sie sich nach initial erfolgreicher Behandlung auch sehr gut für die Erhaltungstherapie. Aufgrund ihrer teratogenen Wirkung dürfen schwangere Frauen und Frauen, die schwanger werden wollen, Vitamin-A-Derivate nicht anwenden.
BPO und topische Antibiotika
Benzoylperoxid und topische Antibiotika wie Erythromycin und Clindamycin haben antimikrobielle Eigenschaften. BPO zeigt eine höhere Potenz gegenüber C. acnes als Antibiotika, verbessert entzündete Akne und hat keratolytische sowie wundheilende Wirkung.
Nachteilig können Trockenheit, Brennen und Rötung der Haut sowie das Verfärben von Textilien sein. Bei ersterem könnte auf eine geringere Konzentration oder auf abwaschbare Formulierungen zurückgegriffen werden, da diese häufig besser vertragen werden. Im Gegensatz zu Antibiotika ist bislang keine Resistenz von C. acnes gegenüber BPO bekannt. Um einer Resistenz gegenüber Antibiotika vorzubeugen, wird die Kombination mit BPO empfohlen. Auch die Kombinationstherapie aus BPO und dem topischen Retinoid Adapalen hat sich als sehr wirksam erwiesen.
Salicylsäure, Azelainsäure und Niacinamid
Weitere häufig eingesetzte Anti-Akne-Wirkstoffe sind Salicylsäure und Azelainsäure. Beide haben komedolytische Wirkung, Azelainsäure wirkt zusätzlich antibakteriell, entzündungshemmend, hellt Hyperpigmentierung auf und wird meist auch von sensibler Haut sehr gut vertragen. Auch Niacinamid wird aufgrund seiner Fähigkeit, die Talgproduktion zu regulieren, häufig zur Behandlung der Akne eingesetzt.
Systemische Therapie
Spricht die Akne auf topische Therapien nicht oder nicht ausreichend an, sind orale systemische Behandlungen mit oralen Antibiotika, Isotretinoin und hormonellen Wirkstoffen gebräuchlich.
• Topische sowie systemische Retinoide (Adapalen, Tretinoin, Isotretinoin etc.)
• Orale Antibiotika der Tetracyclin-Klasse
Orale Antibiotika
Häufig eingesetzte systemische Antibiotika zur Behandlung der mittelschweren bis schweren Akne sind Tetracycline wie Doxycyclin. Diese verbessern das Hautbild durch antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung, sind allerdings während der Schwangerschaft, Stillzeit und bei Kindern unter 8 Jahren kontraindiziert. Weitere Probleme der systemischen Einnahme stellen die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen und Komplikationen wie entzündliche Darmerkrankungen oder vaginale Candida-Infektionen dar.
Isotretinoin
Nach Ansicht internationaler Akneexpert:innen stellt orales Isotretinoin die optimale Therapieoption für Patient:innen mit schwerer oder narbenbildender Akne dar. Weiters wird es eingesetzt, wenn Akne nach Absetzen oraler Antibiotika rasch wieder auftritt oder generell auf andere topische oder systemische Behandlungen nicht anspricht. Isotretinotin ist ein Retinoid, das die Größe und Sekretion der Talgdrüsen reduziert, die Kolonisation sebumabhängiger C. acnes auf der Haut minimiert und indirekt und hemmend auf die Komedonenbildung wirkt, da es die Verhornung der Haut normalisiert. Eine Isotretinoin-Therapie erfordert eine regelmäßige Durchführung von Leberfunktionstests, die Bestimmung des Nüchtern-Lipidprofils und Schwangerschaftstests. Aufgrund fetaler Fehlbildungen durch Isotretinoin ist die Einnahme während der Schwangerschaft verboten und die Schwangerschaftsverhütung während der Therapie zwingend erforderlich.
Kombinierte orale Kontrazeptiva
Die Kombination von Östrogen und Gestagen in oralen Antikonzeptiva wirkt sich durch ihre umfassende antiandrogene Wirkung positiv auf Akne aus. Bei Auswahl dieser Akne-Behandlung sollten allerdings die verschiedenen Einstellungen der Patientinnen bezüglich hormoneller Empfängnisverhütung berücksichtigt werden.
Quellen
1 Linß W: Haut, Integumentum commune und Anhangsgebilde: Drüsen, Glandulae;
Haare, Pili, und Nägel, Ungues. Waldeyer - Anatomie des Menschen (2012), DE GRUYTER, Berlin, Boston.
2 McGrath JA et al.: Structure and function of the skin. In: Barker J et al.:
Rook’s Textbook of Dermatology (2024), 1. Auflage, Wiley.
3 Yousef H et al.: Anatomy, skin (integument), Epidermis (2025), Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.
4 Tuchayi SM et al.: Acne vulgaris (2015), Volume 1, Article number 15029.
5 Piquero-Casals J et al.: Sun exposure, a relevant exposome factor in acne patients and
how photoprotection can improve outcomes. J Cosmetic Dermatol 2023; 22: 1919-1928.
Weitere Literatur auf Anfrage