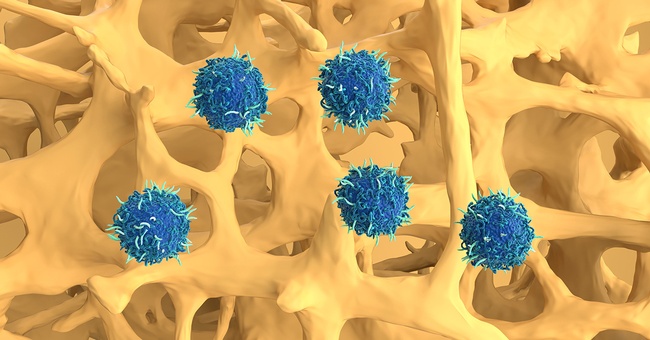Antibiotika-Verbrauchs-Surveillance (AVS)
Alles begann im Jahr 2012 mit einem Anruf von Dr. Ariane Biebl, der Antibiotika-beauftragten Ärztin der Kinderklinik. Bei unserem ersten Treffen im September wurde vieles besprochen und festgelegt, was die folgenden Jahre wesentlich werden sollte.
Strukturelle Charakteristik des AVS:
• Zuerst legten wir fest, welche Stationen für die Auswertung zusammengelegt und welche separat betrachtet werden.
• Durch den Vergleich der Abteilungen innerhalb der Kinderklinik generieren wir
Sie haben bereits ein ÖAZ-Abo?
Ihre Online-Vorteile:
- ✔ exklusive Online-Inhalte
- ✔ gratis für alle Print-Abonnent:innen
- ✔ Überblick über die aktuellen Couponing-Aktionen
Die Österreichische Apotheker-Zeitung informiert über spannende Themen aus Pharmazie, Wirtschaft, Gesundheits- und Standespolitik.
1 Jahr um € 170,00 (zzgl. 10 % Ust.) für Ihre ÖAZ als Printausgabe und Online