.png)
Denn mit der Zeit zerfallen größere Kunststoffteile durch mechanische, thermische und chemische Einflüsse in immer kleinere Fragmente: sogenanntes Mikroplastik. Eine schleichende Belastung begleitet uns im Alltag und stellt ein reales Risiko für unsere (Darm-)Gesundheit dar.
Mikroplastik bezeichnet Kunststoffpartikel mit einer Größe unter 5 mm, die als Folge menschlicher Aktivitäten inzwischen ubiquitär in unserer Umwelt vorkommen. Unsere Böden und Meeresökosysteme sind weltweit teils erheblich aus dem Gleichgewicht geraten, was sich negativ auf deren Eigenschaften, mikrobielle Aktivität, Pflanzenwachstum und schließlich auf unsere Nahrung auswirkt. Die steigende Produktion und Nutzung von Kunststoffen hat zu einer kontinuierlichen Zunahme dieser kleinen Fragmente geführt, die bereits auch im menschlichen Blut nachgewiesen wurden. Die wichtigsten Eintrittspforten in den menschlichen Körper sind dabei der Gastrointestinaltrakt, die Atemwege sowie die Haut.
Ein Großteil der Aufnahme erfolgt über kontaminierte Lebensmittel – insbesondere Meeresfrüchte –, Trinkwasser und die Atemluft. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach der biologischen Wirkung von Mikroplastik auf unser zentrales Stoffwechselorgan: den Darm.
Mikroplastik & der Verdauungstrakt
Der Nachweis von Mikroplastik im menschlichen Stuhl (erstmals 2019) deutet auf eine mögliche Akkumulation im Verdauungstrakt hin und ruft Fragen zur Langzeitwirkung auf. Als zentrales Organ für die Nährstoffaufnahme und als wesentlicher Sitz des Immunsystems ist unser Darm besonders vulnerabel gegenüber solchen Umweltfaktoren. Die Mikroteilchen kommen zunächst mit der Mundschleimhaut und Speiseröhre in Kontakt, passieren den Magen und können sich schließlich in den Lymphfollikeln des Ileums anreichern und persistieren.
Einfluss auf das Darmmikrobiom
Tierexperimentelle Daten zeigen, dass Mikroplastik das Darmmikrobiom signifikant verändert. Es kommt zu einem Rückgang nützlicher Bakteriengattungen und einer vermehrten Besiedelung mit potenziell pathogenen Keimen. Ähnliche Dysbiosen werden auch bei Patient:innen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) beobachtet. Aus heutiger Sicht ist es denkbar, dass auch das menschliche Mikrobiom langfristig unter der Belastung durch Mikroplastik leidet.
Fakten zu Plastikverschmutzung
• Durchschnittlich 5 g Mikroplastik –
in etwa das Gewicht einer Kreditkarte – nimmt jeder Mensch laut WWF pro Woche auf.
• In 93 % der Flaschenwasserproben befand sich laut einer Studie Mikroplastik.
• Zwischen 1.000 und 5.000 Mikroplastikteilchen setzt ein einziger Coffee-
to-go-Becher durch Beschichtung und Erwärmung frei.
• Kosmetik-Check: Mikroplastik wurde in der Vergangenheit in Peelings und Duschgelen als Abrasivstoff (Mikroperlen) verwendet. Seit 2023 ist Mikro-plastik in Kosmetika verboten.
• Bei der Zubereitung von Säuglingsnahrung in Polypropylen-Flaschen können bis zu 16 Millionen Mikroplastikpartikel pro Liter freigesetzt werden. Säuglinge nehmen dadurch ca. zehnmal mehr Partikel auf als Erwachsene.
Mikroplastik als biologischer Störfaktor
Potenzielle Schadmechanismen umfassen neben der Veränderung der mikrobiellen Zusammensetzung die Induktion von oxidativem Stress, eine verstärkte Immunaktivierung sowie Förderung von Entzündungsreaktionen. Sie reizen als Fremdkörper den Darm nicht nur mechanisch, sondern können aufgrund ihrer großen Oberfläche Schadstoffe transportieren.
Die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies führt zur Apoptose epithelialer Darmzellen. Die Integrität der Darmbarriere ist somit gestört und die Darmschleimhaut durchlässiger für Proteine, Bakterien und weitere Mikroplastikpartikel, was Infektionen und Entzündungsreaktionen begünstigt – ein Teufelskreis und möglicher Beitrag zur Entstehung eines Leaky-Gut-Syndroms. Aus Modellen an Tieren und In-vitro-Versuchen wurde dabei eine klare Abhängigkeit von Partikeldurchmesser und Expositionsmenge deutlich: So verweilen insbesondere kleinere Partikel länger im Darm und können sich dort anreichern, während größere schneller ausgeschieden werden.
Klinische Relevanz & Ausblick
Jüngste klinische Daten belegen einen signifikant höheren Mikroplastikgehalt in Stuhlproben von Patient:innen mit CED im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen. Eine positive Korrelation zwischen Partikelanzahl und Krankheitsaktivität wurde ebenfalls beschrieben. Vorbelastete Individuen zeigen teils deutlichere Schleimhautschäden und eine intensivere Immunreaktion.
Trotz der noch jungen Datenlage sind erste Hinweise auf eine mögliche klinische Relevanz vorhanden. Die weitere Erforschung in Humanstudien zur Verifizierung bisheriger Beobachtungen ist dringend notwendig. Die Wissenschaft ist sich einig: Mikroplastik stellt einen Umweltfaktor dar, der mehr Beachtung verdient.
Von der Belastung zur Lösung: Forschung mit Potenzial
Um die gesundheitlichen Risiken von Mikroplastik zu verstehen, braucht es standardisierte Monitoringmethoden – beispielsweise durch gezieltes Einfärben der Partikel, um deren Weg im Körper sichtbar zu machen: von der Aufnahme und Verteilung bis hin zu möglichen Wirkungen.
Ein interessanter Forschungsansatz zur Schadensbegrenzung besteht in der gezielten Aggregation der Mikropartikel zu größeren Komplexen, die im Tiermodell weniger schädlich oder sogar nützlich für den Organismus zu sein scheinen. So wurde bei Karpfen beobachtet, dass toxische Substanzen wie Schwermetalle, organische Schadstoffe oder schädliche Mikroorganismen, gebunden an solche Aggregate, aus dem Tierkörper ausgeleitet werden können. Ein weiterer innovativer Ansatz ist die nachhaltige Biodegradierung durch Regenwürmer, die Mikroplastik in weniger schädliches organisches Material umwandeln können – ein Bereich, in den es sich lohnt, künftig mehr zu investieren.
Trends im Apothekenalltag
Mikroplastik ist längst mehr als ein Umweltproblem. Es ist an der Zeit, diese unsichtbare Gefahr sichtbar zu machen – nicht nur im Labor, sondern auch hinter der Tara. Wir Apotheker:innen haben die Möglichkeit, mithilfe unserer Beratungskompetenz präventiv zu unterstützen. Angepasste Empfehlungen – angefangen bei einer plastikreduzierten Ernährung bis hin zur gezielten Versorgung mit Mikronährstoffen zur Stärkung der Darmbarriere – könnten in Zukunft Teil eines neuen Qualitätsstandards in der pharmazeutischen Beratung werden.
Im Apothekenalltag zeigt sich erfreulicherweise immer häufiger, wie umweltbewusst viele Kund:innen denken und Plastik vermeiden wollen: „Kann ich das Gläschen wieder befüllen lassen?“ – eine Frage, die zunehmend gestellt wird. Auch bei der Körperpflege rückt zertifizierte Naturkosmetik in den Fokus einer gut informierten Kundschaft, die gezielt nach „natürlichen“ oder „schadstofffreien“ Produkten fragt.
Zahnputztabletten, Zahnbürsten aus Bambusholz, feste Shampoos, plastikfreie Wattestäbchen, Taschen aus Leinen oder Refill-Tiegel bei Körperpflegeprodukten sind nur wenige, aber wirkungsvolle Beispiele, die zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Quellen
• Wang YF, et al.: Impact of microplastics on the human digestive system:
from basic to clinical. World J Gastroenterol 2025; 31(4): 100470
• Chen H, et al.: Release of microplastics from disposable cups in daily use.
Sci Total Environ 2023; 854: 158606
• De Wit W, et al.: No plastic in nature:
Assessing plastic ingestion from nature to people.
WWF International (Gland, Switzerland), Dalberg Advisors (Genf, Switzerland), University of Newcastle (Australia), Juni 2019
• Li D, et al.: Microplastic release from the degradation of
polypropylene feeding bottles during infant formula preparation.
Nat Food 2020; 1(11): 746-754
• Tyree C, et al.: Plus plastic: microplastics in bottled water. Independent NGO research report. Washington, D.C., USA: Orb Media + State University of New York Fredonia, September 2018
Weitere Literatur auf Anfrage
Dieser Beitrag wurde von Mag. Pharm. Svetislav Markovic verfasst.




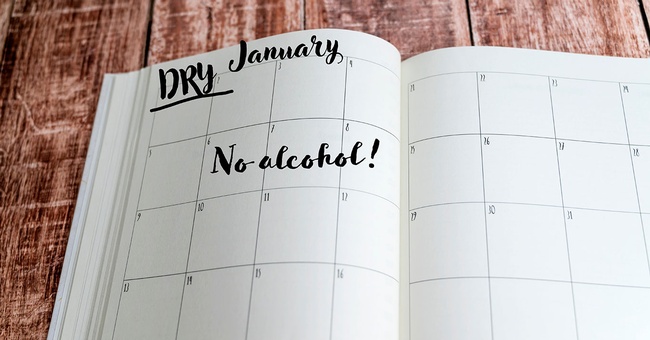
.jpg)