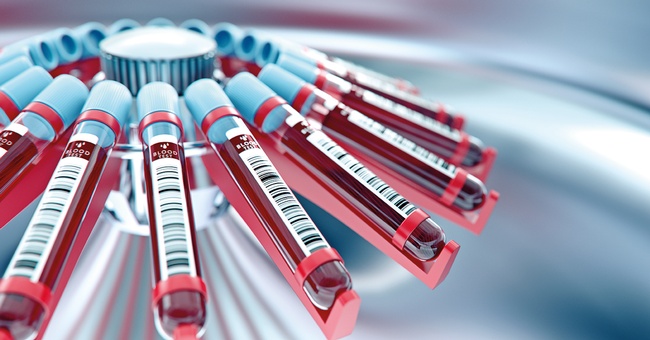Alarmsignale richtig deuten
Fallbeispiel 1
Eine 65-jährige Frau betritt die Apotheke und bittet um eine Blutdruckmessung. Sie berichtet, dass sie sich seit etwa zwei Stunden unsicher auf den Beinen fühle und unter starkem Schwindel leide. Zu Hause habe sie bereits versucht, ihren Blutdruck zu messen, doch ihr Gerät habe heute Morgen wiederholt ungewöhnlich hohe Werte angezeigt – sie vermutet daher eine Fehlfunktion.
Nachdem sie sich setzt, gibt sie an, dass keine weiteren Grunderkrankungen vorliegen und lediglich ein Blutdrucksenker (Amlodipin/Valsartan 10/160 mg) genommen wird. Die in der Apotheke durchgeführte Messung ergibt einen Blutdruck von 190/110 mmHg.
Fallbeispiel 2
Ein 65-jähriger Mann ruft im Bereitschaftsdienst der Apotheke an. Schon zu Beginn des Gesprächs fällt seine verwaschene Sprache auf. Er berichtet, dass er sich plötzlich sehr schwach fühle, ihm schwindelig sei und er auf einer Seite seines Gesichts ein Taubheitsgefühl verspüre. Zudem habe er Schwierigkeiten, seinen rechten Arm richtig zu bewegen.
Besorgt erwähnt er, dass sein Blutdruckmessgerät einen stark erhöhten Wert von 200/115 mmHg angezeigt habe. Vor einigen Monaten habe ihm sein Arzt Amlodipin 5 mg verordnet, mit der Anweisung, es nur einzunehmen, wenn sein Blutdruck über 180 mmHg systolisch liege. Nun sei er sich jedoch unsicher, ob er das Medikament einnehmen solle und fragt Sie, was er tun solle.
Hypertensive Krisen werden grob in zwei Kategorien eingeteilt. Die hypertensive Entgleisung (oder Dringlichkeit) wird wie in Fallbeispiel 1 durch einen Blutdruck über 180/110 mmHg ohne Begleitsymptome und ohne Endorganschäden definiert. Oft bemerken Patient:innen Anzeichen wie einen roten Kopf/Wangen, Kopfschmerzen, Schwindel oder Übelkeit. Der hypertensive Notfall wiederum geht neben der genannten Blutdruckentgleisung mit Endorganschäden und deren Begleitsymptomen einher. Der Patient aus dem Fallbeispiel 2 zeigt neben dem Blutdruckanstieg klar die Anzeichen eines Schlaganfalls und sollte umgehend den Notruf wählen, da er eine sofortige Abklärung und zeitnahe Behandlung braucht. Nach der neuesten nationalen S3-Versorgungsleitlinie „Hypertonie“ soll bei Verdacht auf eine hypertensive Entgleisung je nach Zustand der Patientin/des Patienten nach 30 Minuten in ruhender Position der Blutdruck erneut gemessen werden. Im nächsten Schritt sollte der/die Patient:in ambulant oder ärztlich weiterführend abgeklärt werden.1
Prävalenz

Zur Prävalenz von hypertensiven Krisen gibt es nur sehr wenige Daten. Es hat sich gezeigt, dass in etwa 1 % aller Hypertoniker:innen im Laufe ihres Lebens eine hypertensive Krise erleiden. Zwei Drittel der Betroffenen erleiden eine hypertensive Entgleisung und etwa ein Drittel einen hypertensiven Notfall.
Frauen sind meist von hypertensiven Entgleisungen betroffen, während Männer hingegen häufiger Endorganschäden aufweisen und somit hypertensive Notfälle erleiden.2
Die Differenzialdiagnostik dieser beiden Krankheitsbilder ist essenziell für die weitere Therapie und den Verlauf der Erkrankung. Deshalb sollte bei einem Verdacht auf eine Blutdruckentgleisung unbedingt eine ausführliche Ab-
klärung erfolgen.
Alarmstufe Rot
Ein plötzlicher Blutdruckanstieg kann besonders gefährlich werden, wenn bereits Vorerkrankungen bestehen. Tritt bei den folgenden Krankheitsbildern ein akuter Blutdruckanstieg auf, muss sofort gehandelt werden:
- Akuter Myokardinfarkt
- Instabile Angina pectoris
- Intrazerebrale Blutung
- Ischämischer Schlaganfall
- Präeklampsie, Eklampsie
- Akutes Nierenversagen
- Hypertensive Enzephalopathie
- Hypertensive Retinopathie
- Akute Aortendissektion
- Akute Herzinsuffizienz mit Lungenödem
Pathophysiologie
Die pathophysiologischen Mechanismen hypertensiver Entgleisungen und Notfälle sind vielfältig und nicht vollständig geklärt. Eine zentrale Rolle spielt die Aktivierung des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems (RAAS). Insbesondere
Angiotensin II wird verdächtigt, über die Freisetzung proinflammatorischer Zytokine eine direkte oder indirekt toxische Wirkung auf das Gefäßendothel auszuüben. Dies kann zu ischämischen Zuständen in den Gefäßen führen, wodurch der Gefäßwiderstand steigt. Zusätzlich verstärkt eine durch den
erhöhten Blutdruck ausgelöste Natriurese die Aktivierung des RAAS, was einen Teufelskreis in Gang setzt. Daraus resultieren mikrovaskuläre Schädigungen und eine gestörte Autoregulation, die die Grundlage für Organschäden bilden. 2–
Therapie der hypertensiven Entgleisung
Primäres Ziel ist zunächst, die betroffene Person zu beruhigen und potenzielle Auslöser zu identifizieren. Faktoren wie Schmerzen und Angst können dabei Ursachen oder Kofaktoren einer hypertensiven Entgleisung sein. Zur Senkung des Blutdrucks wird auf eine orale Therapie gesetzt. Kurzwirksame sowie sublinguale Therapien werden eher vermieden, denn eine zu schnelle Senkung des Blutdrucks führt zu einem erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Komplikationen. Die Therapie erfolgt üblicherweise im ambulanten Setting und
wird mithilfe von Calcium-Kanal-Blockern vom Dihydropyridin-Typ wie Amlodipin, Betablockern (z. B. Atenolol, Metoprolol oder Carvedilol), ACE-Hemmern wie Enalapril oder zentralen Sympatholytika wie Clonidin erreicht. In
bestimmten Situationen wird von der nationalen Versorgungsleitlinie „Hypertonie“ schnellwirksames Glyceroltrinitrat zusammen mit stark verzögert wirkendem Amlodipin eingesetzt, um eine akute und moderate Blutdrucksenkung zu erzielen. Nach der Gabe eines blutdrucksenkenden Mittels
wird eine zumindest zweistündige Nachbeobachtungsphase empfohlen, um die Sicherheit und Effektivität zu gewährleisten.3
Therapie des hypertensiven Notfalls
Ein hypertensiver Notfall erfordert eine stationäre Aufnahme mit intensivmedizinischer Überwachung und Behandlung. Die Blutdrucksenkung richtet sich individuell nach den zugrunde liegenden Ursachen. Ziel der Therapie ist es, eine weitere Schädigung von Endorganen sowie langfristige Komplikationen zu vermeiden. Während der Behandlung erfolgt eine engmaschige hämodynamische Überwachung.
In bestimmten Situationen, wie etwa bei einer akuten Aortendissektion oder einem akuten Lungenödem, ist eine rasche und stärkere Blutdrucksenkung erforderlich.3
Im Gegensatz dazu wird beim ischämischen Schlaganfall eine vorsichtige, nur mäßige Senkung angestrebt. Bei stark erhöhten Werten über 220/120 mmHg wird eine Reduktion des mittleren arteriellen Drucks (MAP) um etwa
15 % innerhalb von 24 Stunden empfohlen.
Besteht eine Indikation zur Thrombolysetherapie, muss der Blutdruck zuvor auf unter 185 mmHg systolisch und 110 mmHg diastolisch gesenkt werden, um das Risiko für Komplikationen zu minimieren.3,4
Therapeutika-Gruppen
Beta-Blocker
β1-selektive-Rezeptorblocker wie Metoprolol (oral und parenteral) und Esmolol (parenteral) sowie unselektive β-Blocker wie Carvedilol zählen zu den Vertretern, die bei der Therapie von hypertensiven Krise eingesetzt werden. Mit einer sehr kurzen Halbwertszeit von ca. 10 Minuten ist Esmolol sehr gut steuerbar. Die Halbwertszeit von Metoprolol liegt bei 5–8, jene von Carvedilol bei etwa 6 Stunden. Einsatz finden β-Blocker zur Blutdrucksenkung beim akuten Koronarsyndrom und der Aortendissektion. Hierbei macht man sich auch die Senkung der Herzfrequenz zunutze.
Kontraindiziert ist der Einsatz bei einer schwer dekompensierten Herzinsuffizienz, Bradykardie, höhergradigem AV-Block sowie bei akut exazerbiertem Asthma und COPD.1,2
Diuretika
Diuretika, insbesondere das Schleifendiuretikum Furosemid, werden bevorzugt bei einer hydropischen Dekompensation im Zuge eines kardialen Lungenödems eingesetzt. Bei Elektrolytentgleisungen wie der Hyponatriämie und Hypokaliämie sowie einer Exsikkose besteht jedoch eine Kontraindikation.1,2
ACE-Hemmer
Enalapril (oral oder parenteral) und Captopril werden bei hypertensiven Entgleisungen, auch bei begleitender Herzinsuffizienz häufig oral eingesetzt. Enalapril kann auch intravenös verabreicht werden, ist jedoch schlecht steuerbar. Dadurch kann es bei Patient:innen mit einem gesteigerten RAAS zu einer überschießenden Wirkung kommen, weshalb es beim hypertensiven Notfall eher seltener eingesetzt wird.
Die Wirkung beruht auf der Hemmung des Angiotensin-Converting-Enzyms (ACE), wodurch die Bildung von Angiotensin II reduziert wird. Dies führt zu einer Senkung des peripheren Gefäßwiderstands.
Kontraindikationen bestehen bei bilateraler Nierenarterienstenose, akutem Myokardinfarkt sowie während der Schwangerschaft.1,2
Calciumantagonisten
Durch die Erniedrigung des Gefäßmuskeltonus der glatten Muskulatur werden Calciumantagonisten vom Dihydropyridin-Typ (wie z. B. Amlodipin) in oraler Form bei der hypertensiven Entgleisung verwendet. Ihr Einsatz bei bestehender instabiler Angina pectoris oder akutem Myokardinfarkt ist jedoch kontraindiziert.1,2
Nitrate
Nitrate wie Glyceroltrinitrat verursachen primär eine venöse Vasodilatation und erst in höherer Dosierung eine arterielle Vasodilatation. Bei der hypertensiven Krise, während des akuten Koronarsyndroms oder eines akuten Lungenödems kann Glyceroltrinitrat eingesetzt werden. Gegenanzeigen sind die Anwendung bei erhöhtem intrakraniellen Druck. Auch auf die mögliche Toleranzentwicklung und die selten auftretende Methämoglobinämie muss geachtet werden.1,2
Urapidil
Urapidil wirkt antagonistisch auf die peripheren postsynaptischen α1-Rezeptoren und agonistisch auf die zentralen Serotoninrezeptoren, wodurch es eine Vasodilatation ohne Reflextachykardie bewirkt. Es wird bei hypertensiven Notfällen mit akuter Aortendissektion eingesetzt. Da auch kein Anstieg des intrakraniellen Drucks ausgelöst wird, kann es bei zerebralen Insulten oder hypertensiven Enzephalopathien eingesetzt werden.1,2
Nachsorge
Nach einem hypertensiven Ereignis sollte die bestehende Blutdruckmedikation überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Dabei spielen neben den gewünschten Zielwerten auch Faktoren wie das Alter und die kognitive Verfassung der Patient:innen eine wichtige Rolle. Es ist essenziell, die Patient:innen darüber aufzuklären, wie bedeutend die regelmäßige Einnahme ihrer Blutdruckmedikamente ist und welche gefährlichen Folgen ein abruptes Absetzen (Rebound-Effekt) haben kann.1 Ebenso wichtig ist es, den Blutdruck regelmäßig zu messen – idealerweise zu festen Zeiten wie morgens und abends – und die gemessenen Werte zu dokumentieren. Diese Daten sind entscheidend für die Nachsorge und die Anpassung der Behandlung. Eine anfangs schrittweise Dosissteigerung der Medikamente verbessert die Verträglichkeit und fördert die Akzeptanz bei den Patient:innen.
Zusätzlich sollte eine Medikationsanalyse vorgenommen werden, da auch andere Medikamente den Blutdruck beeinflussen oder zu Entgleisungen führen können. Hierzu zählen unter anderem NSAR, Sympathomimetika, Anabolika, Immunsuppressiva und bestimmte Chemotherapeutika.4
In diesem Zusammenhang hat die Rolle der Apotheker:innen einen entscheidenden Einfluss. Sie sind sowohl im Aufnahme- und Entlassungsmanagement im Krankenhaus wichtig, wo sie die bestehende oder neu verordnete Medikation erfassen, dokumentieren und evaluieren, als auch in öffentlichen Apotheken, wo sie Beratungsgespräche führen, Medikationsanalysen durchführen und pharmazeutische Dienstleistungen wie die Blutdruckmessung anbieten.
Quellen
- Bundesärztekammer (BÄK), Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV),
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). Nationale Versorgungsleitlinie Hypertonie – Langfassung, Version 1.0. 2023. - Obermüller N: Hypertensiver Notfall. Die Intensivmedizin 1–11 (2023)
- Van Den Born BJH, et al.: ESC Council on hypertension position
document on the management of hypertensive emergencies.
Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother 2019; 5(1): 37–46 - Kulkarni S, et al.: Management of hypertensive crisis: British and Irish Hypertension Society Position document J Hum Hypertens 2023; 37(10): 863–879
- Bress AP, et al.: The management of elevated blood pressure
in the acute care setting: a scientific statement from the American Heart Association. Hypertension 2024; 81(8): e94–e106