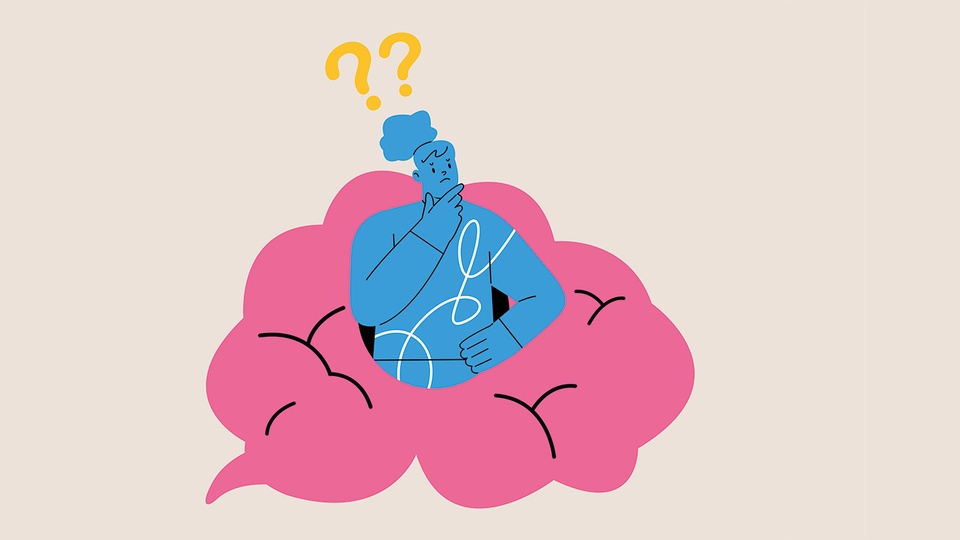
In Österreich sind laut Schätzungen rund 170.000 Menschen an einer Form von Demenz erkrankt. Aufgrund der demografischen Entwicklungen und der zunehmenden Lebenserwartung ist bis 2050 mit einem Anstieg auf rund 230.000 Erkrankungen zu rechnen.
Die Zahl der Menschen mit Demenz nimmt auch weltweit zu. Nach Angaben der WHO leben derzeit mehr als 55 Millionen Menschen mit einer Demenz und jährlich kommen etwa 10 Millionen neue Fälle hinzu. Mit rund 60 bis 70 % aller Fälle ist die Alzheimer-Krankheit die häufigste Demenzform. Weitere häufige Formen sind die Vaskuläre Demenz (15 %), die Lewy-Körperchen-Demenz sowie die Frontotemporale Demenz, eine Degeneration des frontalen Hirnlappens. Eine Demenz kann sich auch nach einem Schlaganfall, nach langjährigem Alkoholmissbrauch sowie nach wiederholten Hirnverletzungen entwickeln.
Frauen sind sowohl direkt als auch indirekt überproportional von Demenz betroffen. Zum einen verlieren sie durch die Krankheit mehr gesunde Lebensjahre, zum anderen leisten Frauen auch rund 70 % der Pflege von Demenzkranken.
Österreichischer Demenzbericht und Demenzstrategie
Der Österreichische Demenzbericht 2025 beleuchtet die zunehmende Herausforderung durch Demenzerkrankungen im Land und skizziert notwendige Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung und Unterstützung von Betroffenen und ihren Angehörigen. Der Demenzbericht verdeutlicht die Dringlichkeit, Demenz als gesamtgesellschaftliche Herausforderung zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Die Kombination aus Prävention, Früherkennung, Unterstützung von Angehörigen und Schulung öffentlicher Institutionen ist entscheidend, um die Lebensqualität von Menschen mit Demenz zu verbessern und ihre Integration in die Gesellschaft zu fördern.
In Österreich existiert eine umfassende Demenzstrategie mit dem Titel „Gut leben mit Demenz“, die seit 2015 in Zusammenarbeit von Bund, Ländern, Sozialversicherungsträgern und Expert:innen entwickelt und umgesetzt wird. Ziel ist es, Menschen mit Demenz und deren Angehörige bestmöglich zu unterstützen und die Gesellschaft für das Thema zu sensibilisieren.
Die zentralen Elemente umfassen:
• Integrierte Versorgung und Früherkennung – Ziel ist es, frühzeitige Diagnosen zu ermöglichen und die Lebensqualität zu steigern.
• Demenzfreundliche Gemeinden und Städte – Initiativen, um Gemeinden demenzfreundlich zu gestalten.
• Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung
• Schulungen für Fachkräfte und Ehrenamtliche
• Koordination und Umsetzung – Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Gemeinden sowie internationalen Kooperationen.
Neue medikamentöse Therapien
Ein vielversprechender Ansatz in der Alzheimer-Therapie sind monoklonale Antikörper, die gezielt gegen Beta-Amyloid-Ablagerungen im Gehirn wirken. Diese Ablagerungen gelten als ein Hauptfaktor für die Entstehung der Alzheimer-Krankheit.
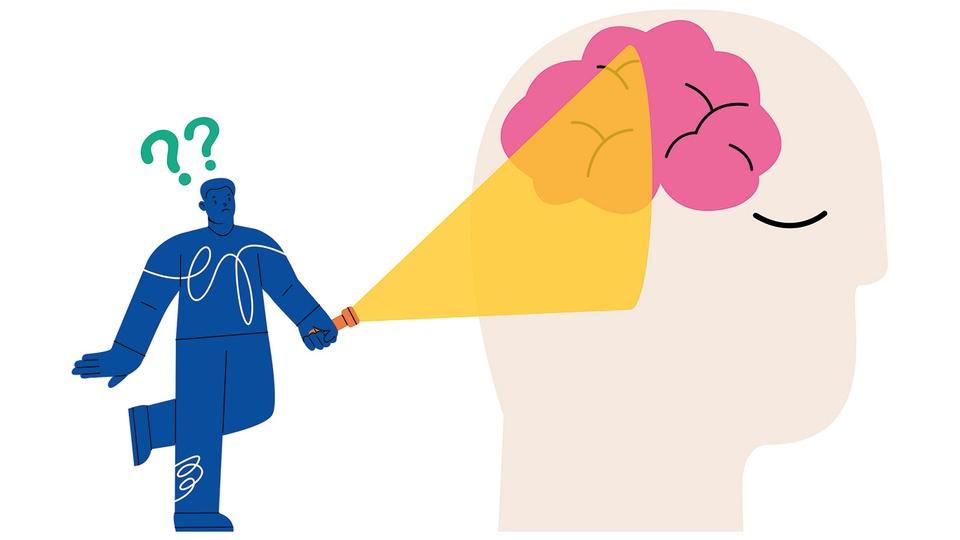
Donanemab
Donanemab (Kisunla®) ist ein monoklonaler Antikörper, der sich in der Behandlung der frühen Alzheimer-Krankheit bewährt hat. Er zielt auf spezifische Beta-Amyloid-Plaques im Gehirn ab und konnte in klinischen Studien die kognitive Verschlechterung signifikant verlangsamen. Allerdings sind auch Sicherheitsbedenken aufgekommen, insbesondere im Hinblick auf das Risiko von ARIA (Amyloid-assoziierte Bildgebungsanomalien).
Die Phase-III-Studie TRAILBLAZER-ALZ 2 umfasste 1.736 Patient:innen mit leichter kognitiver Beeinträchtigung oder leichter Demenz aufgrund der Alzheimer-Krankheit. Die Ergebnisse zeigten eine 35%ige Verlangsamung des kognitiven Verfalls im Vergleich zur Placebo-Gruppe, gemessen mit der Integrated Alzheimer Disease Rating Scale (iADRS). Zusätzlich wurde eine 36%ige Verlangsamung des funktionellen Verfalls festgestellt. Die Behandlung mit Donanemab ist nicht ohne Risiken. In der TRAILBLAZER-ALZ 2-Studie traten bei 36,8 % der Patient:innen ARIA-E (Ödem) oder ARIA-H (Hämorrhagien) auf. Symptomatische ARIA-E wurden bei 6,1 % der Patient:innen beobachtet, während 31,4 % ARIA-H entwickelten. Donanemab wurde bereits in mehreren Ländern zugelassen. In Europa empfahl die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) im März 2025 die Ablehnung der Zulassung von Kisunla® aufgrund von Sicherheitsbedenken, insbesondere im Hinblick auf ARIA. Im Juli 2025 entschied sich die EMA nach einer erneuten Prüfung anders und erteilte eine Zulassungsempfehlung.
Es wurden auch Studien durchgeführt, in denen Donanemab mit anderen Wirkstoffen im direkten Vergleich stand. Eine davon ist die Studie TRAILBLAZER-ALZ 4. Ziel war es, den Unterschied in der Amyloid-Reduktion zwischen Donanemab und Aducanumab festzustellen. Donanemab reduzierte die Amyloid-Plaques im Gehirn nach sechs Monaten um 65,2 %, während Aducanumab nur 17 % erreichte.
Bislang verfügbare medikamentöse Therapieoptionen
Acetylcholinesterase-Hemmer (AChE-Hemmer)
Diese Medikamente erhöhen die Konzentration des Neurotransmitters Acetylcholin im Gehirn, was die Kommunikation zwischen Nervenzellen verbessert. Sie werden vor allem bei leichter bis mittelschwerer Alzheimer-Demenz eingesetzt. Diese Substanzen können die kognitive Leistungsfähigkeit stabilisieren und die Lebensqualität der Patient:innen verbessern. Wirkstoffe aus dieser Gruppe sind Donepezil, Rivastigmin und Galantamin.
NMDA-Rezeptor-Antagonist
Memantin wirkt, indem es die Effekte von Glutamat
moduliert. Es wird vor allem bei moderater bis schwerer Alzheimer-Demenz eingesetzt, um die Symptome zu lindern und das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen.
Pflanzliche Präparate
Ginkgo-biloba-Spezialextrakte (z. B. EGb 761®) werden
verwendet, um die Durchblutung im Gehirn zu fördern und antioxidative Effekte zu erzielen. Sie können bei leichten kognitiven Beeinträchtigungen unterstützend wirken.
Neue Krankheitsmodifizierende Therapien
Diese neuen Medikamente zielen darauf ab, die zugrunde liegenden pathophysiologischen Prozesse der Demenz
zu beeinflussen, insbesondere bei Alzheimer-Demenz.
Anti-Amyloid-Antikörper
Diese Substanzen binden an Beta-Amyloid-Plaques im Gehirn, die mit der Alzheimer-Erkrankung in Verbindung
stehen, und fördern deren Abbau.
• Lecanemab (Leqembi®): Ein humanisierter Antikörper, der in den USA und der EU zugelassen ist. Er zeigt eine moderate Verzögerung des kognitiven Abbaus im
frühen Krankheitsstadium.
• Donanemab (Kisunla®): Ein weiterer Anti-Amyloid-Antikörper, der in den USA bereits zugelassen wurde. In der EU wurde er zunächst aufgrund unzureichender Nutzen-Risiko-Bewertung abgelehnt, wenige Monate später
eine Zulassungsempfehlung ausgesprochen.
Tau-Antikörper
Diese Medikamente richten sich gegen Tau-Proteine, die sich in den Nervenzellen ablagern und zum Zelltod führen können.
• E-2814: Ein Antikörper, der in klinischen Phase-III-Studien getestet wird und in der EU zugelassen werden soll.
Weitere krankheitsmodifizierende Ansätze
Es gibt mehrere weitere Wirkstoffe in Entwicklung,
die unterschiedliche Mechanismen ansprechen, darunter:
• Blarcamesin (vgl. ÖAZ 18/25, S. 22): Ein Sigma-1-Rezeptor-Agonist, der neuroprotektive Effekte haben könnte.
Im EU-Zulassungsverfahren seit Dezember 2024.
• Masitinib: Ein Kinase-Inhibitor, der neuroinflammatorische Prozesse im Gehirn moduliert. Derzeit in Phase-3-Studie.
• Semaglutid: Ein GLP-1-Analogon, das neurotrophe Effekte besitzen soll. Derzeit in Phase-III-Studie.
Lecanemab
Der Antikörper Lecanemab (Leqembi®) wurde entwickelt, um Protofibrillen von Beta-Amyloid zu erkennen und deren Ablagerung zu verhindern. 2025 wurde Lecanemab von der Europäischen Kommission erstmals als Alzheimer-Medikament zugelassen, das gezielt auf die Krankheitsprozesse einwirkt. Die AHEAD-Studie (Anti-Amyloid Treatment in Asymptomatic Alzheimer’s Disease) ist eine internationale klinische Phase-III-Studie, die sich mit der Behandlung von Personen im präklinischen Stadium der Alzheimer-Krankheit befasst. Diese Personen zeigen noch keine klinischen Symptome, weisen jedoch erhöhte Amyloid-Ablagerungen im Gehirn auf, die als frühe Marker für Alzheimer gelten. Die AHEAD-Studie besteht aus zwei Hauptarmen:
• A3-Studie: Teilnehmer:innen mit grenzwertigen Amyloidwerten im Gehirn
• A45-Studie: Teilnehmer:innen mit positiven Amyloidwerten im Gehirn
In beiden Gruppen wurden die Wirksamkeit und Sicherheit von Lecanemab untersucht. Die Studie zeigte, dass die Behandlung mit Lecanemab im Vergleich zu Placebo zu einer signifikanten Verringerung der Amyloid-Ablagerungen im Gehirn führte. Diese Reduktion war bereits nach drei Monaten sichtbar und blieb über den gesamten Behandlungszeitraum stabil. Darüber hinaus wurde eine Verlangsamung des kognitiven Verfalls beobachtet, was auf das Potenzial hinweist, das Fortschreiten der Krankheit in einem sehr frühen Stadium zu verzögern.
Im April 2025 erteilte die Europäische Kommission die Zulassung für Lecanemab in der EU. Allerdings ist die Anwendung auf Patient:innen mit leichtem kognitivem Defizit oder leichter Demenz im Frühstadium der Alzheimer-Krankheit beschränkt. Zudem dürfen nur Patient:innen mit maximal einer Kopie des ApoE4-Gens behandelt werden, da Träger:innen dieses Gens ein höheres Risiko für Nebenwirkungen wie Hirnschwellungen und Blutungen (Amyloid-assoziierte Bildgebungsanomalien, ARIA) aufweisen.
Die CLARITY AD-Studie ist eine internationale, randomisierte, doppelblinde Phase-III-Studie, die die Wirksamkeit und Sicherheit von Lecanemab bei Patient:innen mit leichter kognitiver Beeinträchtigung (MCI = mild cognitive impairment) oder leichter Alzheimer-Demenz untersucht. Insgesamt nahmen 1.795 Teilnehmer:innen an der Studie teil, wobei 898 Patient:innen Lecanemab und 897 ein Placebo erhielten. Die Behandlung erfolgte alle zwei Wochen mit einer Dosis von 10 mg/kg Körpergewicht über einen Zeitraum von 18 Monaten. Fazit: Lecanemab zeigte eine signifikante Verlangsamung (27 %) des kognitiven Abbaus bei Patient:innen mit leichter Alzheimer-Demenz. Obwohl es mit einigen Nebenwirkungen verbunden war, insbesondere ARIA, wurden diese meist als mild eingestuft. Die Ergebnisse unterstützen die potenzielle Rolle von Lecanemab als therapeutische Option in der frühen Phase der Alzheimer-Erkrankung. Folgende Nebenwirkungen traten auf: Amyloidbedingte Bildgebungsanomalien (ARIA) – ARIA-E (Ödeme) traten bei 12,6 % der Patient:innen in der Lecanemab-Gruppe auf, ARIA-H (Mikroblutungen) bei 17,3 %. Die Mehrheit dieser Fälle war asymptomatisch und mild. Milde bis moderate infusionsbedingte Reaktionen erlitten 26,4 % der Patient:innen in der Lecanemab-Gruppe. Kopfschmerzen (11,1 %) und Stürze (10,4 %) wurden ebenfalls berichtet.
Quellen
• www.demenzstrategie.at
• www.sozialministerium.gv.at
• www.alzheimer-forschung.de
• Rafii MS, et al.: The AHEAD 3-45 Study: Design of a prevention trial for Alzheimer's disease. Alzheimers Dement 2023; 19(4): 1227-1233
• Van Dyck CH, et al.: Lecanemab in early Alzheimer’s disease. N Engl J Med 2023; 388: 9-21
Weitere Literatur auf Anfrage
Sabine_Klimpt.jpg)





