
Charakteristik der Migräne: Abgrenzung zu anderen Kopfschmerzarten
Migräneattacken dauern unbehandelt 4–72 Stunden, sind meist einseitig, pulsierend und von mittlerer bis starker Intensität. Typisch sind Begleitsymptome wie Übelkeit, Erbrechen, Licht- und Lärmempfindlichkeit sowie eine Verstärkung durch Bewegung. Bei etwa einem Drittel der Betroffenen geht der Attacke eine Aura mit neurologischen Symptomen wie Sehstörungen oder Sensibilitätsstörungen voraus. Spannungskopfschmerzen sind meist beidseitig, dumpf-drückend, leichter und ohne vegetative Symptome. Clusterkopfschmerzen sind selten, sehr stark, streng einseitig (oft orbital) und treten in Serien auf – meist mit Tränenfluss oder Nasenlaufen.
Akuttherapie: Von NSAR bis CGRP-Antagonisten
Leichte bis mittelstarke Attacken sprechen oft gut auf herkömmliche Schmerzmittel wie NSAR, teils kombiniert mit Koffein, an.
Bei Unverträglichkeit können Metamizol oder Paracetamol Alternativen bieten. Triptane gelten als Mittel der Wahl bei schweren Attacken. Die Kombination mit Naproxen kann Rückfälle mindern. Triptane sind kontraindiziert bei schweren kardiovaskulären Grunderkrankungen (z. B. KHK, pAVK, St.p. Insult oder schwerer Hypertonie). Die gleichzeitige Einnahme von MAO-Hemmern oder Mutterkornalkaloiden ist ebenso eine Gegenanzeige wie die Einnahme während der Aura. Bei Triptan-Kontraindikationen bieten sich Lasmiditan (5-HT1F-Agonist) oder Rimegepant (CGRP-Antagonisten) an. Lasmiditan wirkt zentral, ohne Vasokonstriktion, wirkt jedoch sedierend und kann zu Schwindel führen und somit die Verkehrstüchtigkeit beeinflussen. Rimegepant ist auch zur Prophylaxe zugelassen und im Gegensatz zu den Antikörpern auch als perorale Arzneiform verfügbar. Antiemetika wie Metoclopramid oder Domperidon lindern Übelkeit und verbessern die Resorption oraler Schmerzmittel. Opioide sind nicht empfohlen.
Prophylaxe – individuell abwägen
Eine Prophylaxe ist angezeigt bei ≥ 3 Attacken/Monat, sehr langen Verläufen oder unzureichender Akuttherapie. Etablierte Mittel sind Betablocker (Propranolol, Metoprolol), Amitriptylin, Flunarizin sowie Topiramat und Valproinsäure – letztere bei Frauen im gebärfähigen Alter nur eingeschränkt nutzbar.
Flunarizin sollte nach sechs Monaten pausiert werden. Monoklonale Antikörper gegen CGRP oder dessen Rezeptor (Erenumab, Galcanezumab, Fremanezumab, Eptinezumab) stellen neue Therapieoptionen dar, sind wirksam und gut verträglich. Die Wirkung ist meist nach 4–12 Wochen beurteilbar.
Beratung in der Apotheke: Evidenzbasiert und empathisch
Frau T. S., 39 Jahre, ist Stammkundin in der Apotheke und beruflich als LKW-Fahrerin im internationalen Fernverkehr tätig. Sie sucht Beratung zur Migränebehandlung. Seit über zehn Jahren leidet sie unter typischen Attacken mit halbseitigem, pulsierendem Kopfschmerz, Lichtempfindlichkeit, Übelkeit und teils Auraphänomenen (z. B. Flimmerskotome). Die Anfälle treten aktuell 6–8-mal pro Monat auf und führen zunehmend zu Arbeitsausfällen. Ihre Bedarfsmedikation (Zolmitriptan) wirkt nicht mehr zuverlässig – in letzter Zeit seien häufig zwei Dosen nötig gewesen, oft ohne ausreichende Wirkung.
Vor zwei Wochen wurde wegen belastungsabhängiger Wadenschmerzen eine pAVK (Stadium IIa) diagnostiziert. Im Rahmen der kardiovaskulären Abklärung erfolgte eine Anpassung der Medikation. Frau T. S. wiegt 88 kg bei 1,68 m Körpergröße. Sie raucht rund 30 Zigaretten täglich, hat einen erhöhten Blutdruck und eine familiäre Vorbelastung für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie äußert den Wunsch, mit dem Rauchen aufzuhören. Wichtig ist ihr eine wirksame Migränetherapie, die ihre Fahrtauglichkeit nicht einschränkt.
Grunderkrankungen
Migräne mit Aura, pAVK Stadium IIa, Hypertonie, Nikotinabusus,
metabolisches Risiko (Adipositas Grad I)
Medikation
Rosuvastatin Tbl. 20 mg 1-0-0-0
Candesartan/HCT Tbl. 16/12,5 mg 1-0-0-0
Amlodipin Tbl. 5 mg 1-0-0-0
Zolmitriptan 2,5 mg Schmelztabletten bei Bedarf
Metoclopramid Tbl. 10 mg bei Bedarf
Ibuprofen/Koffein Tbl. 400/100 mg bei Bedarf
Den kompletten Fall inkl. Auflösung finden Sie auf der
e-Learning-Plattform der Österreichischen Apothekerkammer unter www.apofortbildung.at
Eine evidenzbasierte, individuelle medikamentöse Therapie – unter Beachtung von Komorbiditäten, Patientenpräferenzen und Lebensumständen – ist zentral. Bei der Abgabe von Mitteln zur Akuttherapie oder Prophylaktika sind Hinweise zur Einnahme (z. B. frühzeitige Einnahme in der Schmerzphase), Dosierungsgrenzen zur Vermeidung von Übergebrauch und mögliche Nebenwirkungen essenziell. Ein Kopfschmerztagebuch kann zur Evaluation beitragen und sollte empfohlen werden. Nicht zuletzt spielen auch nicht-medikamentöse Maßnahmen eine Rolle – etwa regelmäßiger Ausdauersport, Biofeedback oder Entspannungstechniken. Diese können mit der Pharmakotherapie kombiniert werden.
Team „Fall des Monats“
(Autor:innen und Lecture Board)
MMag. pharm. Danielle Hochhold, MSc
Mag. pharm. Dr. Elisabeth Kretschmer, aHPh
Mag. pharm. Alexander Schmidt-Ilsinger, MSc
Mag. pharm. Iris Kubik
Zur Klarstellung für alle Pharmakovigilanz-beauftragten: Bei den Fallbeispielen handelt es sich um Lehrbeispiele, die möglichst praxisnah formuliert wurden. Es besteht daher keinerlei Abklärungsbedarf hinsichtlich einer allfälligen Pharmakovigilanzmeldung.
Quellen
• AMBOSS. (2025, 14. Mai). Migräne. Wissen für Mediziner. https://www.amboss.com/de/wissen/Migräne
• Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN)S1-Leitlinie: Therapie der Migräneattacke und Prophylaxe der Migräne (2024).
(AWMF-Register-Nr. 030-057). https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/030-057.html
• Austria Codex Fachinformation



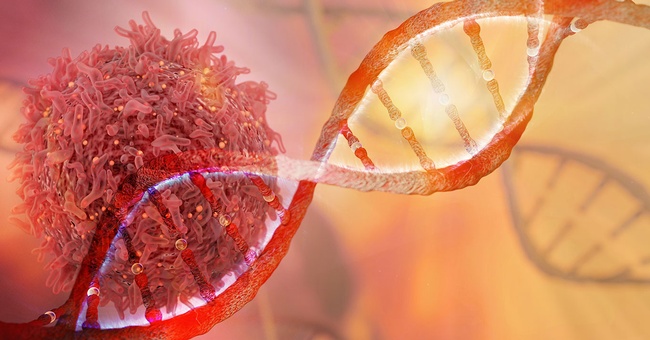


.jpg)