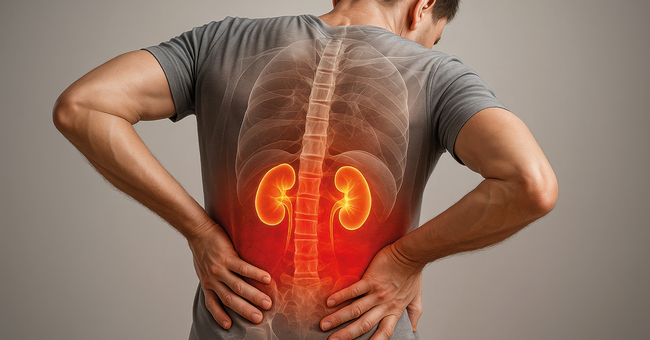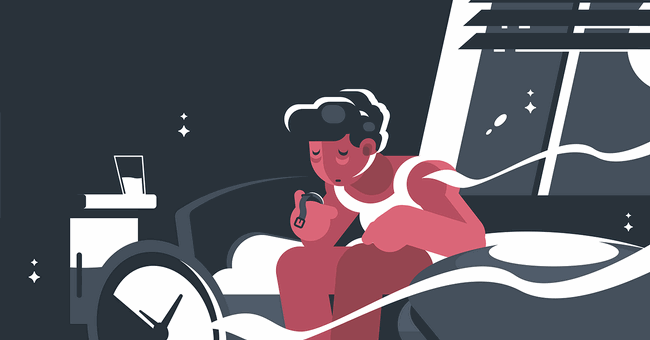Infektiöse Durchfallerkrankungen sind meist selbstlimitierend, verursachen aber unangenehme Symptome. Speziell Kinder und Säuglinge können dadurch akut vital gefährdet sein und benötigen in vielen Fällen sogar eine intravenöse Flüssigkeitssubstitution. Im Alter von ein bis fünf Jahren stellen sie die zweithäufigste Ursache für einen Aufenthalt in der Notaufnahme dar.1
Wichtig bei einer ambulant erworbenen Gastroenteritis ist die sorgsame Anamneseerhebung. Dabei müssen mögliche Rückschlüsse auf die Infektionsquelle (Nahrungsmittelanamnese, Tierkontakte) und Risikofaktoren für eine C. difficile-Infektion berücksichtigt werden. Zu den Risikofaktoren zählen eine vorangegangene Antibiotikaexposition, Fieber, Blutbeimengung im Stuhl, Immunsuppression sowie epidemiologische Häufungen. Da die infektiöse Gastroenteritis meist selbstlimitierend ist und größtenteils durch enteropathogene Viren verursacht wird, ist bei leichten Verläufen keine Erregerdiagnostik indiziert. Laut aktueller S2k-Leitlinie „Gastrointestinale Infektionen“ sollte eine genaue Erregerdiagnostik erst bei schwerem Krankheitsverlauf erfolgen – bei blutiger Diarrhoe, Fieber, Dehydrierung oder Sepsis.1
Spitzenreiter bei den viralen Auslösern sind bei Erwachsenen Noroviren und bei Kindern Rotaviren. Bei den bakteriellen Erregern stehen Campylobacter spp. und Salmonellen ganz vorne.1,2
Virale Gastroenteritis
Noroviren
Noroviren gelten als hochinfektiös und besonders umweltresistent. Sie werden primär über Schmierinfektion, aber auch über die Ausscheidung virushältiger Aerosole nach dem Erbrechen übertragen. Bei einem bestätigten Verdacht muss auf besondere Hygieneschutzmaßnahmen geachtet werden, etwa das Tragen von Mund-Nasenschutz, Einzelzimmerunterbringung, regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren mit viruzidem Händedesinfektionsmittel und Oberflächendesinfektion. Noroviren sind der Hauptgrund für Ausbrüche von Gastroenteritiden in Gemeinschaftseinrichtungen, Krankenhäusern oder Altenheimen. Der Mensch ist das einzige Reservoir des Erregers. Die Inkubationszeit ist meist kurz und beträgt zwischen 6 und 50 Stunden. In den ersten 48 Stunden während der symptomatischen Phase ist die Ansteckungsgefahr am höchsten, aber auch 7–14 Tage nach der akuten Phase werden Erreger noch über den Stuhl ausgeschieden. Symptomatisch treten schwallartiges Erbrechen und starke Durchfälle auf, oft in Verbindung mit abdominellen Schmerzen, Myalgien und Mattigkeit. Eine leicht erhöhte Körpertemperatur kommt bei Norovirus-Infektionen vor, hohes Fieber jedoch selten.1,3

Rotaviren
Rotaviren sind die häufigste Ursache viraler Gastroenteritiden bei Kindern, besonders im Alter von 6 Monaten bis 2 Jahren. Da Kinder erst nach den ersten Lebensjahren durch wiederholte Rotavirus-Infektionen eine spezifische Immunabwehr aufbauen, wird nach dem österreichischen Impfplan eine Schluckimpfung ab der vollendeten 6. Lebenswoche empfohlen. Im Erwachsenenalter treten Rotavirus-Infektionen vor allem als Reisediarrhoe in meist milder Form auf. Hauptreservoir der Rotaviren ist der Mensch. Die Übertragung erfolgt fäkal-oral besonders über Schmierinfektion, kann aber auch über kontaminiertes Wasser und Lebensmittel stattfinden. Die Viren sind ebenfalls hochinfektiös. Die Inkubationszeit beträgt 1–3 Tage. Meist werden die Viren bis zu 8 Tage über den Stuhl ausgeschieden und sind in der Zeit ansteckungsfähig. Symptomatisch beginnt eine Rotavirus-Enteritis mit wässrigen Durchfällen und Erbrechen. Oft finden sich Schleimbeimengungen im Stuhl, da sich das Virus in der Epithelschicht der Dünndarmzotten vermehrt und eine Abstoßung der obersten Zellschicht verursacht. Dazu können auch Fieber und abdominelle Schmerzen auftreten. Üblicherweise bestehen die gastrointestinalen Beschwerden zwischen 2–6 Tage. Bei Säuglingen und Kleinkindern kommt es meist zu schwereren Verläufen mit starker Dehydratation. Bei mehr als der Hälfte der Fälle sind auch unspezifische respiratorische Symptome zu beobachten.1,4
Bakterielle Gastroenteritis
Campylobacter spp.
Eine Campylobacter-Enteritis ist die häufigste bakterielle Ursache einer Gastroenteritis. Beim Menschen ist sie überwiegend lebensmittelbedingt. Rohes und unzureichend gegartes Fleisch (im Speziellen Hühnerfleisch), aber auch nicht pasteurisierte (Roh)milch und kontaminiertes Trinkwasser sind Infektionsquellen von Campylobacter jejuni oder C. coli. Die Inkubationszeit liegt im Schnitt bei zwei bis fünf Tagen. Viele Infektionen mit Campylobacter-Arten verlaufen asymptomatisch. Die symptomatische Infektion beginnt mit einer Prodromalphase 12–24 Stunden vor Auftreten der enteritischen Symptome mit Fieber, Kopfschmerzen, Myalgien und Mattigkeit. Danach überwiegen Diarrhoe (nicht selten auch blutig), Bauchschmerzen, Fieber und Mattigkeit. Im Schnitt dauert die Erkrankung in etwa eine Woche. Gefährlich ist die Campylobacter-Enteritis bei immungeschwächten Personen, da auch ein chronischer Verlauf möglich ist.1,5
Für weiterführende Erregerdiagnostik
• Blutiger Durchfall
• Schwerer Krankheitsverlauf
(z. B. Fieber, Dehydrierung, Sepsis)
• Dauer der Erkrankung länger als 14 Tage
• Komorbiditäten mit erhöhtem Komplikationsrisiko
• Immunsuppression
• Antibiotikaeinnahme in den letzten drei Monaten
oder andere Risiken für C. difficile-Infektionen
• Im Krankenhaus erworbener Durchfall
• Vor empirischer Gabe von Antibiotika
• Tätigkeit in der Nahrungsmittelverarbeitung
• Fallhäufungen mit potenziellem epidemiologischem
Zusammenhang
asten 1, adaptiert nach Carolin Manthey et al.1

Salmonellen
Salmonellen sind gramnegative Stäbchen und verursachen meist unkomplizierte lokale Darminfektionen (Salmonellosen). Speziell die Erreger
Salmonella enteritidis und Salmonella typhimurium in kontaminierten Lebensmitteln sind ursächlich für diese Erkrankung. Sie sind in Eiern, rohem Fleisch, unzureichend erhitzten Fleischprodukten, aber auch in Lebensmitteln pflanzlichen Ursprungs zu finden. Nicht zu verwechseln sind sie mit den verwandten Erregern Salmonella typhi und S. paratyphi, welche systemische Infektionen mit meist einer sekundären Darmbeteiligung auslösen und hauptsächlich in der Reisemedizin von Bedeutung sind. Reservoir für Erreger einer Salmonellose sind meist Tiere (landwirtschaftliche Nutztiere), wobei diese nur selten daran erkranken. Die Inkubationszeit liegt bei 6–72 Stunden. Klinisch manifestiert sich eine Salmonellose mit plötzlich einsetzendem Durchfall, Kopfschmerzen, Magenkrämpfen und manchmal Erbrechen, begleitet von leichtem Fieber. Die Symptome bestehen oft bis zu 10 Tage.1,6
MÖGLICHE ERREGER
Bakterien
• Escherichia coli
• Yersinia enterocolitica
• Y. pseudotuberculosis
• Clostridioides difficile
• Campylobacter jejuni
• Campylobacter coli
• Salmonellen
• Shigellen
• Vibrio cholerae
• Aeromonas
• Plesiomonas
• Listerien
• Tropheryma whipplei
• Staphylococcus aureus
• Bacillus cereus
• Clostridium perfringens
Viren
• Rotaviren
• Adenoviren
• Noroviren
• Sapoviren
• Zytomegalieviren
Protozoen
• Cryptosporidium parvum
• Entamoeba histolytica
• Cyclospora cayetanensis
• Isospora belli
Helminthen
• Trematoden
• Schistosoma
• Zestoden
• Trichinellen
• Strongyloides Stercoralis
Kasten 2, adaptiert nach Carolin Manthey et al.1
Therapie
Orale Rehydratation und Supplementation
Die wichtigste Maßnahme in der Therapie ist die Flüssigkeits- und Elektrolytsubstitution. Bei einer ausgeprägten Symptomatik werden spezielle orale Rehydratationslösungen mit einer vorgegebenen Konzentration an Glukose, Natriumchlorid, Kaliumchlorid und Natriumcitrat empfohlen. Die Natrium- und Glukose-Konzentrationen in dieser Lösung sind so optimiert, dass mithilfe des in den Enterozyten vorhandenen SGLT-1 Transporters Glukose (oder Galaktose) mit Natrium über einen gekoppelten Kotransport effektiver aus dem Darmlumen aufgenommen werden. Wasser folgt dem gerichteten Natriumstrom in der Folge passiv nach.1,2
Für die praktische Anwendung ist es entscheidend, dass orale Rehydratationslösungen stets mit der vorgegebenen Menge Wasser zubereitet werden. Um die Verträglichkeit und Akzeptanz – insbesondere bei Übelkeit – zu verbessern, empfiehlt sich die gekühlte und schluckweise Gabe der Rehydratationslösung.1,2
Zink als essenzielles Spurenelement in verschiedenen Zellvorgängen spielt auch bei der Integrität der Mukosabarriere und bei der Produktion von Antikörpern gegen Darmpathogene eine relevante Rolle. Bei einem ausgeprägten Zinkmangel, beispielsweise durch Mangelernährung, wird die Supplementation von Zink empfohlen, wodurch die Dauer des Durchfalls in Studien verkürzt wurde.2
Probiotika
Momentan gibt es nach derzeitigem Stand laut aktueller S2k-Leitlinie zu Gastrointestinalen Infektionen keine konkrete Empfehlung für den Einsatz von Probiotika bei einer infektiösen Gastroenteritis. Da sich die Zusammensetzung der einzelnen Präparate unter den Herstellern sehr voneinander unterscheidet, ist ein Vergleich untereinander schwierig.1

Antiemetika
Bei starkem akutem Erbrechen kann bei Erwachsenen der Einsatz von Antiemetika wie Metoclopramid oder Ondansetron in Erwägung gezogen werden. Dabei ist zu beachten, dass Metoclopramid einen prokinetischen Effekt besitzt, der eine Diarrhoe verschlimmern kann. Ondansetron hingegen kann die QTc-Zeit verlängern, was insbesondere bei kardial vorerkrankten Patient:innen und bei gleichzeitiger Einnahme weiterer QTc-verlängernder Medikamente ein Problem darstellt. Dies gilt umso mehr bei bestehendem Elektrolytverlust.
Auch das H1-Antihistaminikum Dimenhydrinat kann zur Linderung des Erbrechens beitragen und zeigte in Studien eine signifikante Wirksamkeit. Laut aktueller Leitlinie sollte es jedoch bei Kindern nicht eingesetzt werden, da die sedierenden und anticholinergen Nebenwirkungen möglicherweise zu einer Beeinträchtigung der Nahrungsaufnahme führen könnten.1
Antidiarrhoika
Der Einsatz von Loperamid bei Erwachsenen ohne Fieber und ohne Blut im Stuhl kann für einen kurzen Zeitraum von 48 Stunden erwogen werden. Auch Racecadotril, welches in Österreich in einer rezeptfreien und rezeptpflichtigen Form auf dem Markt ist, kann bei Erwachsenen kurzfristig eingesetzt werden. Auch viele weitere pflanzlichen Antidiarrhoika können zum Einsatz kommen, finden jedoch in der aktuellen Leitlinie aufgrund der fehlenden kontrollierten Studien dazu keine klare Empfehlung.1
Antibiotika
Eine empirische Antibiotikatherapie wird bei einer unkomplizierten Form der infektiösen Gastroenteritis nicht empfohlen, da sie in den meisten Fällen selbstlimitierend ist. Zudem sind die meisten Fälle viraler Natur und können nur symptomatisch behandelt werden.
Bei immunsupprimierten Patient:innen, bei klinischen Hinweisen auf eine systemische Infektion (z. B. Fieber > 38,5 °C) oder bei blutiger Diarrhoe kann jedoch eine empirische Antibiotikatherapie indiziert sein, insbesondere zur Überbrückung bis zum Vorliegen der Erregerdiagnostik, um eine potenzielle Verschlechterung zu verhindern.
Das Mittel der Wahl ist hierbei das Makrolid-Antibiotikum Azithromycin, das bei Erwachsenen entweder mit 500 mg über drei Tage oder alternativ als Einmaldosis von 1.000 mg verabreicht wird. Fluorchinolone, die früher häufig verwendet wurden, sind aufgrund zunehmender Resistenzen und möglicher schwerwiegender Nebenwirkungen nicht mehr als Therapie der ersten Wahl empfohlen.1
Quellen
1 Carolin Manthey AF, et al.: S2k-Leitlinie - Gastrointestinale Infektionen der Deutschen Gesellschaft Für Gastroenterologie, Verdauungs-und Stoffwechselkrankheiten (DGVS), 2023.
2 Posovszky C, et al.: S2k Leitlinie - Akute infektiöse Gastroenteritis im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter – Update 2024. Z Gastroenterol 2024; 62: 1574–1643
3 Robert-Koch-Institut (RKI). Norovirus-Gastroenteritis. https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/RKI-Ratgeber/Ratgeber/Ratgeber_Noroviren.html (2019).
4 Robert-Koch-Institut (RKI): Rotaviren-Gastroenteritis (Stand 2019)
5 Robert-Koch-Institut (RKI): Campylobacter-Enteritis (Stand 2019)
Weitere Literatur auf Anfrage