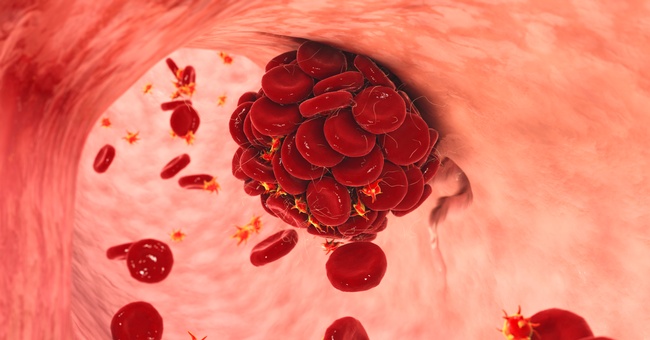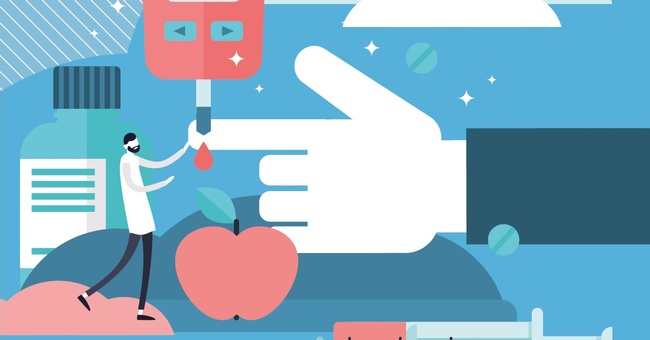Das Auge ist eines unserer elementaren Sinnesorgane – gleichzeitig aber auch äußerst empfindlich und anfällig für Reizungen, Infektionen oder degenerative Veränderungen. In der Apotheke begegnen wir regelmäßig Kund:innen mit Augenbeschwerden, die von harmlosen Irritationen bis hin zu ernsthaften Krankheitsbildern reichen. Für eine umfangreiche Beratung ist ein fundiertes Wissen über Ursachen, Symptome sowie geeignete therapeutische Maßnahmen unerlässlich, um eine sichere Versorgung zu gewährleisten und rechtzeitig auf eine ärztliche Abklärung hinzuweisen.
• Chronischen/rezidivierenden Bindehautreizungen
• Chronischen/rezidivierenden trockenen Augen ohne ärztliche Diagnose
• Starken Schmerzen und/oder Sehstörungen
• Nicht entfernbaren Fremdkörpern
• Traumata
• Verdacht auf infektiöses Geschehen
• Pupillenveränderungen
• Fehlendem Lidschluss
• Säuglingen und kleinen
Kindern
Was sind apothekenrelevante Augenerkrankungen?
Apothekenrelevante Augenerkrankungen sind Erkrankungen oder Beschwerden des Auges, die der Selbstmedikation zugänglich sind und bei denen Apotheker:innen eine wichtige Beratungsfunktion übernehmen. Wenngleich keine offizielle Definition, wird sich der vorliegende Beitrag an dieser Grundidee orientieren und häufige okuläre Krankheitsbilder, ihre Entstehung und Optionen für deren Behandlung diskutieren.

Trockenes Auge
Die Keratokonjunktivitis sicca („dry-eye-syndrome“) ist ein weit verbreitetes Krankheitsbild in der Augenheilkunde, dem meist ein instabiler Tränenfilm (evaporative Form), seltener eine gestörte Tränenproduktion (aqueous-defiziente Form) zugrunde liegt. Dies begünstigt entzündliche Prozesse, welche das Epithel nachhaltig schädigen. Zu den Hauptsymptomen gehören Augenbrennen, Juckreiz und Fremdkörpergefühl. Externe Faktoren wie Rauch, Wind, trockene Luft, Klimaanlagen, längere visuelle Anstrengungen und Kontaktlinsen können den Reizzustand auslösen oder verschlimmern.
Die Behandlung trockener Augen orientiert sich an Ursache, Schweregrad und Patientenbedürfnissen. Ziel ist es, den Tränenfilm zu stabilisieren, Entzündungen zu reduzieren und damit die okuläre Oberfläche zu schützen. Dafür hat sich eine mehrmals tägliche Basistherapie mit nichtkonservierten Tränenersatzmitteln bewährt, wobei niedrigviskose Präparate vor allem tagsüber, hochviskose primär abends/nachts verabreicht werden (Visusbeeinträchtigung).
Der mit Abstand gängigste Wirkstoff in freiverkäuflichen Ophthalmika ist Hyaluronsäure, die mit ihren wasserbindenden Eigenschaften den Tränenfilm stabilisiert und für eine ausreichende Hydratisierung sorgt. Ectoin ist ein aus salzliebenden oder thermophilen Bakterienarten gewonnener Naturstoff.
Er umgibt Proteine und Zellmembranen mit einer schützenden Schicht und wirkt hydratisierend und membranstabilisierend. Trehalose, ein aus Pilzen gewonnenes Disaccharid, verfügt über eine hohe Wasserbindungskapazität und verhindert ein Austrocknen des Auges. Berichten Patient:innen über gereizte, brennende Augen schon beim Aufwachen, bietet sich ein Therapieversuch mit Retinol an, das als aktivierte Form von Vitamin A Bestandteil des Sehfarbstoffs Rhodopsin ist. Retinol unterstützt die Regeneration der Augenoberfläche und fördert den Neuaufbau des Epithels, insbesondere während der Nacht. Bei vordergründigem Juckreiz, unspezifischen Augenreizungen sowie leicht entzündeten Augen ist Dexpanthenol eine Option. Die Alkohol-Vorstufe von Vitamin B5 ist in Form von Coenzym A am Aufbau und der Regeneration von Haut und Schleimhäuten beteiligt.
Meibomdrüsen-Dysfunktion
Meibomdrüsen sind modifizierte Talgdrüsen in der Tarsalplatte der Lider, welche die äußere lipidreiche Phase des Tränenfilms (Meibum) produzieren. Ist diese Schicht zu dünn, wird der Tränenfilm schneller instabil, was die Verdunstung der wässrigen Phase beschleunigt und zu den typischen Symptomen des „Trockenen Auges“ führt. Anhaltspunkte, die klinisch auf eine Meibomdrüsen-Dysfunktion hinweisen, sind verdickte, gerötete Lidränder sowie Sehstörungen nach dem Blinzeln, die sich tagsüber verschlechtern.

Diese Patient:innen profitieren von lipidhaltigen Tränenersatzmitteln auf Triglyzerid-, Paraffin- oder Phospholipidbasis. Derartige Formulierungen sind leicht an ihrem milchigen Aussehen zu erkennen. Tropfen werden wie üblich in den Bindehautsack getropft, Augensprays auf das geschlossene Lid gesprüht. Ergänzend ist eine Lidrandpflege sinnvoll. Dies beinhaltet die lokale Anwendung von Wärme (verflüssigt Meibum) mit anschließender Massage (fördert Sekretion und Verteilung) und Reinigung.
Nichtinfektiöse Konjunktivitis
Patient:innen mit nichtinfektiösen Bindehautentzündungen präsentieren sich in der Regel mit Tränenfluss, geröteten Augen, Augenbrennen und ausgeprägter Lichtscheu. Ursächlich sind unter anderem kalter Wind, UV-Strahlen oder Chlorwasser („Badewasser-Konjunktivitis“). Hier können die bereits erwähnten konservierungsmittelfreien Tränenersatzmittel auf wässriger Basis Linderung verschaffen. Naphazolin ist ein Sympathomimetikum, das – lokal angewendet – durch seine direkte alpha-adrenergene Wirkung zu einer Vasokonstriktion der Bindehaut/Konjunktiva und somit zu einer Abschwellung der Bindehaut und einer Hemmung der Sekretproduktion führt. Ihre Anwendung sollte nur kurzfristig erfolgen (Gefahr von Rebound-Hyperämie und Gewöhnungseffekte); bei Patient:innen mit Engwinkelglaukom und Blasenentleerungsstörungen ist sie kontraindiziert. Bei nicht entfernbaren Fremdkörpern, Verletzungen des Auges oder Verdacht auf eine infektiöse Genese (eitriger Ausfluss, streng einseitige Beschwerden) ist ärztliche Hilfe gefragt.

Allergische Konjunktivitis
Eine Sonderform der Bindehautentzündung ist die allergische Konjunktivitis, die auf dem vorherigen Kontakt mit Baum- und Gräserpollen, Hausstaubmilben oder Tierhaaren beruht. Der direkte Kontakt mit Allergenen triggert die Degranulation von Mastzellen unter massiver Ausschüttung von Botenstoffen. Leitsymptome der allergischen Konjunktivitis sind ein starker Tränenfluss, juckende Augen sowie Rötung und Schwellung der Bindehaut. Zur Behandlung eignen sich lokal wirksame Antihistaminika wie Azelastin und Levocabastin, welche die allergische Reaktion unterbrechen und Histamin von seinem Rezeptor verdrängen. Therapiebegleitend kann die Vermeidung von Allergenen durch z. B. Waschen von Haaren und Gesicht, Thermalsprays und Berücksichtigen des Pollenwarndienstes empfohlen werden.
Gerstenkörner
Akute eitrige Entzündungen der Liddrüsen im Wimpern- oder Augenlidkantenbereich werden Gerstenkörner (Hordeolum) genannt. Augenärzt:innen unterscheiden zwischen Hordeolum externum, einer Entzündung der äußeren Liddrüsen, und Hordeolum internum, einer Entzündung der tiefer im Lid liegenden Meibom-Drüsen. Gerstenkörner entstehen infolge einer ungefährlichen Infektion mit Staphylokokken. Die bakterielle Besiedelung verursacht Follikulitis und Abszessbildung, was als lokale Schwellung, Rötung, Schmerzen und Eiterbildung imponiert. Zu den Risikofaktoren zählt Diabetes. Das wiederholte Auftreten von Gerstenkörnern kann deshalb Ausdruck eines geschwächten Immunsystems mit zugrundeliegender Erkrankung sein.

Aufgrund der bakteriellen Beteiligung können desinfizierende bzw. antibakterielle Augensalben und -tropfen die Abheilung eines Gerstenkorns unterstützen. Ihr Gebrauch ist in der Selbstmedikation jedoch stark eingeschränkt. Antibiotische Zubereitungen unterliegen generell der Rezeptpflicht. Bibrocathol wird laut Fachinformation nur bei Lidrandentzündungen angewendet, die nicht durch Bakterien verursacht werden. Eine mögliche Option bietet die magistrale Herstellung und zeitlich befristete Anwendung von Povidon-Iod-Augentropfen. Zusätzlich kann Betroffenen eine trockene Wärmeanwendung mit Rotlicht oder warmen Kompressen zur schnelleren Reifung des Abszesses empfohlen werden.
Hagelkörner
Ein Hagelkorn (Chalazion) ist eine chronisch granulomatöse Entzündung einer verstopften Meibom-Drüse im Augenlid. Durch den verstopften Ausführungsgang staut sich das lipidreiche Meibum, was eine Fremdkörperreaktion im umliegenden Gewebe bedingt. Anders als das Gerstenkorn ist das Hagelkorn also nicht bakteriell-infektiös, sondern eine sterile Entzündung. Sie ist in erster Linie ein kosmetisches Problem und heilt für gewöhnlich nach einigen Wochen bis Monaten komplikationslos ab.
Der Heilungsprozess von Hagelkörnern wird durch Rotlicht oder trockene Wärmekompressen beschleunigt. Dadurch löst sich verhärtetes Sekret, welches die Ausführungsgänge blockiert. Möglichen Schmierinfektionen sollte durch hinreichende Augenhygiene vorgebeugt werden. Kommt es dennoch zu einer Sekundärinfektion, sind lokale Antibiotika indiziert.
Hyposphagma
Hyposphagma beschreibt eine flächenhafte, scharf umrissene Einblutung unter die Bindehaut (subkonjunktivale Blutung), die schmerzlos und ohne Beeinträchtigung der Sehschärfe verläuft. Für gewöhnlich treten solche Blutungen nach einer verstärkten Druckbelastung (z. B. Husten, Niesen) oder spontan bei zugrundeliegenden Erkrankungen (v. a. Diabetes, arterielle Hypertonie, Medikation mit Antikoagulanzien) auf. Können anamnestische Traumata erfragt werden oder berichten Patient:innen von Schmerzen oder Sehstörungen, ist eine augenärztliche Untersuchung notwendig, um Begleitverletzungen auszuschließen.
Hyposphagma sind meist harmlos und heilen innerhalb von ein bis zwei Wochen von selbst ab. Eine spezifische medikamentöse Therapie ist daher nicht notwendig. Es macht allerdings Sinn, vorübergehend auf Kontaktlinsen zu verzichten und damit potenziellen Reizungen vorzubeugen. Viele Patient:innen empfinden kühle Kompressen als angenehm. Bei Fremdkörpergefühl oder Reizung können wässrige Tränenersatzmittel eingesetzt werden.
Quellen
• Dahlmann C: Basics Augenheilkunde (2024), 6. Auflage, Urban & Fischer, Elsevier GmbH München.
• Lennecke K, Hagel K: Selbstmedikation – Leitlinien zur pharmazeutischen Beratung (2021), 7. Auflage, Deutscher Apotheker Verlag, Stuttgart.
• Geisslinger G et al.: Mutschler Arzneimittelwirkungen (2021), 11. Auflage, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart.