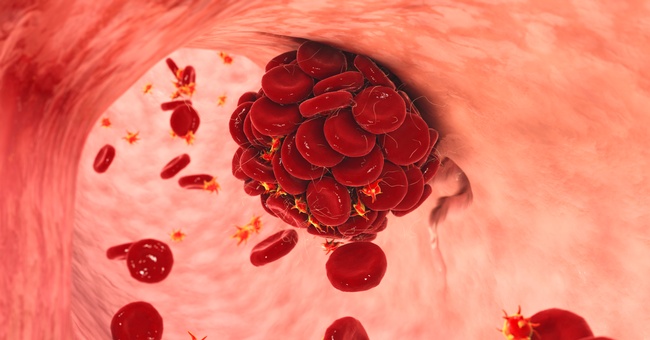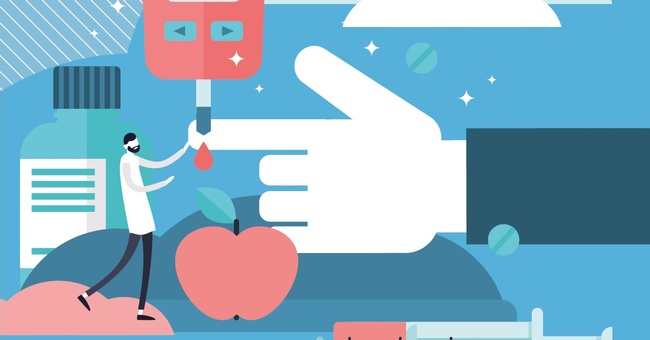Fast 120 Jahre ist es her, dass der Wiener Kinderarzt Clemens von Pirquet den Begriff „Allergie“ in die medizinische Fachliteratur einführte. Er kreierte den Ausdruck aus den griechischen Wörtern „allos“, eine Abweichung von der ursprünglichen Verfassung, und „ergon“, was für eine aktive Handlung oder Tätigkeit steht (siehe Kasten unten). Heute versteht man unter Allergie eine fehlgeleitete und stark überschießende Immunantwort auf eigentlich harmlose Fremdstoffe, die eine allergische Reaktion mit körperlichen Beschwerden zur Folge hat.
Zunehmende Prävalenz
In den letzten Jahrzehnten hat die Häufigkeit allergischer Erkrankungen weltweit stark zugenommen. Diese Entwicklung ist nicht nur auf die genetisch determinierte Disposition zur Produktion von IgE-Antikörpern (sog. Atopie) zurückzuführen, sondern auch auf Umweltveränderungen, Lebensstilfaktoren und eine zunehmende Verschmutzung der Luft. In Österreich leidet etwa jede:r Sechste an einer Allergie, was 16 % der Bevölkerung und umgerechnet ca. 1,5 Millionen Menschen entspricht. Die häufigsten Erscheinungsformen sind die allergische Rhinitis („Heuschnupfen“) und die allergische Konjunktivitis (Bindehautentzündung, „juckende Augen“). Unbehandelte Allergien der oberen Atemwege können gemäß der „Etagenwechsel-Hypothese“ auf die unteren Atemwege übergreifen und sich dort als Asthma bronchiale manifestieren. Eine rasche Diagnose und Behandlung sind daher wichtiger denn je. Die Vielzahl möglicher Auslöser erfordert eine gezielte Abklärung, vor allem, wenn Betroffene schwerwiegende allergische Reaktionen entwickeln oder sich in ihrer Lebensqualität stark beeinträchtigt fühlen. Neue Behandlungsmöglichkeiten wie die allergenspezifische Immuntherapie (AIT) bereichern das therapeutische Arsenal und ermöglichen immer häufiger eine maßgeschneiderte Therapie. Angesichts der steigenden Inzidenz und zunehmenden Komplexität müssen Apotheker:innen auf dem neuesten Stand bleiben, um Betroffene optimal beraten zu können.

Beratung und Aufklärung
Bei milden allergischen Beschwerden wie Heuschnupfen, Juckreiz oder Hautirritationen suchen Betroffene häufig zuerst die Apotheke auf. Dort erhalten sie fundierte Beratung zu Allergieauslösern und geeigneten rezeptfreien Medikamenten. Besondere Aufmerksamkeit verdienen dabei Patient:innen mit speziellen Bedürfnissen: Schwangere, Stillende, Kinder und ältere Menschen benötigen individuell angepasste Therapieempfehlungen. Apotheker:innen übernehmen zudem eine wichtige Filterfunktion: Sie erkennen schwerwiegende allergische Reaktionen und Komplikationen, die eine ärztliche Abklärung erfordern. Darüber hinaus können sie bereits präventiv tätig werden, indem sie Patient:innen frühzeitig auf Risikofaktoren hinweisen, vorbeugende Maßnahmen empfehlen und die korrekte Medikamenteneinnahme sicherstellen.
„(…) Wir brauchen ein neues, allgemeines, nicht präjudizierendes Wort für die Zustandsänderung, die der Organismus durch die Bekanntschaft mit irgendeinem organischen, lebenden oder leblosen Gifte erfährt. Der Geimpfte verhält sich gegenüber der Lymphe, der Luetische gegenüber dem Syphilisvirus, der Tuberkulöse gegenüber dem Tuberkulin, der mit Serum Injizierte gegenüber dem Serum anders als ein Individuum, welches mit dem betreffenden Agens noch nicht in Berührung gekommen ist; er ist deswegen noch weit entfernt, unempfindlich zu sein. Alles, was wir von ihm sagen können, ist, dass seine Reaktionsfähigkeit geändert ist. Für diesen allgemeinen Begriff der veränderten Reaktionsfähigkeit schlage ich den Ausdruck Allergie vor.“
adaptiert nach Pirquet et al.
Primäre Allergieprävention
Maßnahmen der Primärprävention zielen darauf ab, die Entstehung allergischer Krankheiten zu reduzieren, bevor diese auftreten. Da eine Sensibilisierung gegenüber Allergenen sehr früh im Leben geschieht, beginnen primärpräventive Maßnahmen schon während der Schwangerschaft und setzen sich nach der Geburt beim Stillen und bei der Beikosteinführung fort.

Vor der Geburt
Fachgesellschaften empfehlen schwangeren Frauen eine ausgewogene, abwechslungsreiche und nährstoffdeckende Ernährung. Diese umfasst den Verzehr von Gemüse und Milchprodukten (einschließlich fermentierter Milchprodukte wie Joghurt), Obst, Nüssen, Eiern und Fisch. Nahrungsmittel durch diätetische Restriktionen bewusst zu meiden, soll aus Gründen der Allergieprävention ausdrücklich nicht erfolgen. Bislang vorliegende Daten erlauben keine Empfehlung hinsichtlich der Gabe von Prä- und Probiotika. Eindeutiger ist die Evidenz für Tabakrauch und Alkoholkonsum. Beides erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine Sensibilisierung und Allergie beim Kind.
Nach der Geburt
Stillen stellt die natürlichste Form der Säuglingsernährung dar und ist neben positiven Einflüssen auf die Mutter-Kind-Beziehung auch mit vorteilhaften Effekten hinsichtlich Allergien assoziiert. Mütter sollten nach Möglichkeit in den ersten vier bis sechs Monaten ausschließlich stillen. Bei Stillwunsch sollte auf die Zugabe von kuhmilchbasierter Säuglingsanfangsnahrung verzichtet werden. Für Mütter, die nicht stillen können oder wollen, bietet Säuglingsanfangsnahrung mit in Studien nachgewiesener allergiepräventiver Wirksamkeit eine Alternative (z. B. hydrolysierte Säuglingsanfangsnahrung auf Kuhmilchbasis). Für sojabasierte Produkte und andere Tiermilchprodukte ist eine allergiepräventive Wirkung nicht belegt. Pflanzliche Getreidedrinks sind aus ernährungsphysiologischer Sicht kein adäquater Muttermilchersatz.
Die Beikosteinführung kann ab dem vierten Lebensmonat beginnen, sofern der Säugling bereit ist. Üblich ist zunächst ein Gemüse-Kartoffel-Fleisch-Brei, der ab dem 6. Lebensmonat um einen Vollmilch-Getreide-Brei sowie einen Getreide-Obst-Brei ergänzt wird. Dem Säugling können auch Fisch, begrenzte Mengen Milch (max. 200 ml/Tag) bzw. Naturjoghurt sowie durcherhitztes Hühnerei und Erdnussprodukte in altersgerechter Form angeboten werden. In Studien verringerten eine frühe Beikosteinführung und abwechslungsreiche Ernährung im ersten Lebensjahr die Häufigkeit von atopischer Dermatitis und allergischen Atemwegserkrankungen. Die im angloamerikanischen Raum verbreitete frühe Einführung von Erdnussbrei in Familien mit einem Risikokind (mindestens ein Elternteil oder Geschwister leidet an einer atopischen Erkrankung) zur Vorbeugung einer Erdnussallergie ist in Österreich nicht üblich.
Behandlung von Allergien
Für die Akutbehandlung allergischer Reaktionen stehen zahlreiche OTC-Medikamente zur Verfügung.
Antihistaminika: Klassiker der Allergietherapie
Am häufigsten abgegeben werden zweifelsohne Wirkstoffe aus der Gruppe der Antihistaminika, die mit hoher Affinität an den Histamin-H1-Rezeptor binden und damit die Freisetzung des Botenstoffs Histamin unterbinden. Ältere Substanzen der ersten Generation wie Dimetinden überqueren die Blut-Hirn-Schranke, was zu Müdigkeit und eingeschränkter Fahrtüchtigkeit führen kann. Demgegenüber bleiben die Effekte von Antihistaminika der zweiten Generation, darunter Loratadin, Cetirizin und Fexofenadin, auf die Peripherie beschränkt. Die in Nasensprays und Augentropfen enthaltenen Wirkstoffe Azelastin und Levocabastin erlauben die Behandlung lokaler Beschwerden. Sie überzeugen mit einem schnellen Wirkeintritt und fehlenden systemischen Nebenwirkungen, können jedoch bei ausgeprägten Symptomen unter Umständen zu schwach wirken.

Mastzellstabilisatoren: Präventiver Ansatz
Will man verhindern, dass Histamin und andere Entzündungsmediatoren freigesetzt werden, ist Cromoglicinsäure eine Option. Sie stabilisiert die Zellmembran von Mastzellen und verhindert, dass diese degranulieren. Die Wirkung tritt verzögert nach ungefähr zwei Wochen konsequenter Anwendung ein. Als Bedarfsmedikation ist Cromoglicinsäure deshalb ungeeignet. Anders als in Deutschland, wo es mehrere Darreichungsformen gibt (Inhalationslösung, Kapseln, Granulat), muss man sich in Österreich mit Nasenspray und Augentropfen begnügen, die zur Zusatzbehandlung allergischer Rhinitis bzw. allergisch bedingter Bindehautentzündung zugelassen sind.
Dekongestiva:
Schnelle Erleichterung mit Vorsicht
Alpha-Sympathomimetika wie Naphazolin, Xylometazolin und Oxymetazolin verengen Gefäße und wirken dadurch schleimhautabschwellend. Sie erleichtern eine ungehinderte Nasenatmung. Präparate in Tropfenform können zudem die Eustachische Röhre öffnen, die den Nasenrachenraum mit dem Mittelohr verbindet und dem Druckausgleich dient. Die vasokonstriktorische Wirkung von alpha-Sympathomimetika lässt sich auch bei allergisch bedingter Bindehautentzündung nutzen, aufgrund des starken Gewöhnungseffekts allerdings nicht länger als 24–48 Stunden. Bei Nasensprays und -tropfen haben sich 7–10 Tage als maximale Anwendungsdauer etabliert.
Corticosteroide:
Goldstandard bei allergischer Rhinitis
Nasal verabreichte Corticosteroide reduzieren die Bildung und Freisetzung entzündungsfördernder Botenstoffe, was bei kontinuierlicher Gabe prophylaktisch vor neuen Symptomen schützt. Ihrer guten Wirksamkeit auf sämtliche Kernsymptome ist es zu verdanken, dass Fluticason und Co. Mittel der ersten Wahl bei allergischer Rhinitis sind. In Deutschland sind Corticosteroid-haltige Nasensprays bei ärztlich diagnostizierter allergischer Rhinitis bereits Teil des OTC-Sortiments.
Fazit
Apotheker:innen sind eine unverzichtbare Ressource in der niederschwelligen Behandlung allergischer Reaktionen. Sie bieten nicht nur eine erste Anlaufstelle für die Auswahl und Anwendung von Medikamenten, sondern spielen auch eine wichtige Rolle bei der Früherkennung von ernsthaften Allergien und deren Komplikationen. Durch ihre Beratungskompetenz können sie maßgeblich dazu beitragen, die Lebensqualität von Menschen mit Allergien zu verbessern und den Zugang zu medizinischer Versorgung zu erleichtern.
Quellen
• Abou-Dakn M, et al.: Ernährung und Bewegung von Säuglingen und stillenden Frauen. Monatsschr Kinderheilkd 2024; 172: 901–904
• European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology & Nutrition (ESPGHAN) et al. World Health Organization (WHO) guideline on the
complementary feeding of infants and young children aged 6-23 months 2023: A multisociety response. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2024; 79(1): 181-188
• Huber B: 100 Jahre Allergie: Clemens von Pirquet - sein Allergiebegriff und das ihm zugrunde liegende Krankheitsverständnis :
Teil 2: Der Pirquet'sche Allergiebegriff. Wien Klin Wochenschr 2006; 118(23-24): 718-727
• Kopp MV, et al.: S3-Leitlinie Allergieprävention. AWMF-Register-Nr. 061-016. Allergol Select 2022; 6: 61-97
• Obbagy JE, et al.: Complementary feeding and food allergy, atopic dermatitis/eczema, asthma, and allergic rhinitis: a systematic review.
Am J Clin Nutr 2019; 109(Suppl_7): 890S-934S
Weitere Literatur auf Anfrage