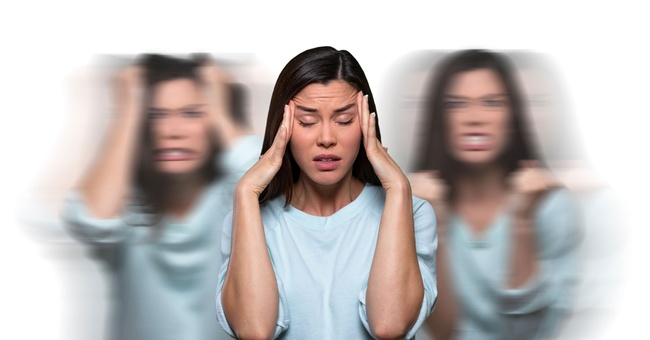Colchicin ist ein trizyklisches Alkaloid, das als Gift der Herbstzeitlosen (Colchicum autumnale) bekannt ist.1 Schon früh erkannte man seine Nützlichkeit, aber auch seine Toxizität. Die ersten Aufzeichnungen zu Colchicin als Gichtmittel sind bereits im altägyptischen Papyrus Ebers zu finden und damit immerhin 3.500 Jahre alt.1 Die vollsynthetische Herstellung des Wirkstoffs ist seit 1959 möglich, sie geht auf den Schweizer Chemiker Albert Eschenmoser zurück.2
In Österreich ist Colchicin derzeit in Form von Tabletten zu 1, 0,5 und 0,372 mg registriert.3 Alle Präparate sind zur Therapie des akuten Gichtanfalls sowie zur Vorbeugung eines Gichtanfalls zu Beginn einer harnsäuresenkenden Therapie indiziert, des Weiteren zur Anfallsprophylaxe beim Familiären Mittelmeerfieber. Einzelne Präparate führen als Anwendungsgebiet außerdem die Primärbehandlung einer akuten oder rezidivierenden Perikarditis (Herzbeutelentzündung) auf.
Colchicin beim akuten Gichtanfall
Gemäß den aktuellen Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie und Klinische Immunologie gelten sowohl Colchicin als auch Glucocorticoide und NSAR als gleichwertige Mittel der ersten Wahl zur Behandlung eines akuten Gichtanfalls.4 Die medikamentöse Anfallskupierung sollte möglichst zeitnah erfolgen, um die Dauer des Gichtanfalls zu verkürzen und Gewebeschäden zu verringern (idealerweise innerhalb von 12 Stunden). Die üblichen Dosierungsschemata haben sich im Lauf der Zeit verändert. Früher gebräuchliche Hochdosistherapien (anfangs 1,2 mg Colchicin, gefolgt von stündlich 0,6 mg für 6 Stunden) sind heute obsolet. Im Jahr 2010 konnte gezeigt werden, dass eine Niedrigdosis-Behandlung eine vergleichbare Wirksamkeit bei verbessertem Sicherheitsprofil erzielt.1 Gebräuchliche Niedrigdosis-Schemata sind beispielsweise 1,2 oder 1 mg als Initialdosis, gefolgt von 0,6 oder 0,5 mg nach einer Stunde (länderspezifisch je nach verfügbaren Stärken).1 Der überwiegende Anteil der österreichischen Fachinformationen gibt eine Dosierung von 2–3 x täglich 0,5 mg an, gegebenenfalls davor eine Anfangsdosis von 1 mg.5 Die Behandlung muss beendet werden, sobald der akute Anfall abgeklungen ist oder wenn nach 2–3 Tagen keine Besserung eintritt. Bei gastrointestinalen Nebenwirkungen wie Durchfall oder Erbrechen muss Colchicin sofort abgesetzt werden, da es sich um erste Anzeichen einer Intoxikation handeln kann. Pro Behandlungszyklus dürfen laut Fachinformation nicht mehr als 6 mg eingenommen werden. Ein neuer Zyklus darf frühestens nach 3 Tagen begonnen werden.5
Colchicin zur Prophylaxe eines Gichtanfalls
Unter bestimmten Umständen wird bei Gichtpatient:innen die Indikation für eine dauerhafte harnsäuresenkende Therapie gestellt, z. B. mit Allopurinol. Dies ist im Allgemeinen dann der Fall, wenn die Betroffenen mehr als einen Anfall pro Jahr haben, die Anfälle besonders beeinträchtigend sind oder bereits sicht- und tastbare Gichtablagerungen (Tophi) bestehen.4 Durch die Senkung der Serum-Harnsäure und die folgende Mobilisation der Harnsäurepools besteht zu Anfang einer solchen Therapie ein erhöhtes Risiko für neuerliche Gichtanfälle, unabhängig vom verwendeten Wirkstoff.4 Die parallele Prophylaxe mit Colchicin kann dieses Risiko bei geeigneten Patient:innen verringern.4 Üblich sind dazu 0,5–1 mg abendlich eingenommenes Colchicin für eine Dauer von 8 Wochen bis 6 Monaten.1,5
Colchicin beim Familiären Mittelmeerfieber (FMF)
Das FMF ist eine autosomal-rezessiv vererbte autoinflammatorische Erkrankung, die gehäuft bei der Bevölkerung der östlichen Mittelmeerregion auftritt und durch Migrationsbewegungen auch in anderen Ländern zunimmt. Die Krankheit zeichnet sich durch wiederkehrende, selbstlimitierende Fieberschübe von 1–3 Tagen aus, die meist mit starken Bauchschmerzen und anderen Manifestationen an serösen Membranen einhergehen. Eine gefürchtete Komplikation ist die systemische Amyloidose, die zur Ablagerung von Amyloidfibrillen in Organen, speziell der Niere, führt und ein chronisches Nierenversagen mit Transplantationsbedarf nach sich ziehen kann.1 Colchicin ist das Mittel der Wahl zur Therapie des FMF, sowohl als Akuttherapie als auch zur Vorbeugung einer Amyloidose.1,5 In der Indikation FMF darf Colchicin auch Kindern, Schwangeren und Stillenden verordnet werden.1,5,6
Wirkmechanismus von Colchicin bei Gicht
Der Wirkmechanismus von Colchicin bei Gicht ist nicht vollständig bekannt.5 Es wird angenommen, dass der Wirkstoff verschiedenste pathogenetische Aspekte der Gicht beeinflusst.1,7 Das Alkaloid reichert sich insbesondere in neutrophilen Granulozyten an und stört als Antimitotikum (Spindelgift) deren Mikrotubulifunktion.1 Es hemmt die Adhäsion, Extravasion und Rekrutierung von Neutrophilen und moduliert die Leukozyten-bedingte Inflammation.1 Weiters wird die Aktivierung des NLRP3-Inflammasoms gehemmt, was die Freisetzung nachgeschalteter proinflammatorischer Zytokine unterdrückt. In Summe wirkt Colchicin bei Gicht antiinflammatorisch und hemmt die Formierung von Harnsäurekristallen. Es hat jedoch keinen Einfluss auf den Harnsäurespiegel in Blut oder Urin, da es den Harnsäuremetabolismus nicht beeinflusst.1,5
Toxizität: die Schattenseite von Colchicin
Das Mitosegift Colchicin weist eine enge therapeutische Breite auf.7 Es ist jedoch schwierig, eindeutige Grenzen zwischen nicht-toxischer, toxischer und letaler Dosis zu ziehen, da dies u. a. von medikamentösen Interaktionen, dem Körpergewicht und Begleiterkrankungen abhängt (z. B. Nieren- und Leberinsuffizienz, Lebensalter).7 Die niedrigsten oralen Dosen, die letal waren, lagen zwischen 7 und 26 mg. Eine akute Aufnahme von über 0,5 mg/kg Körpergewicht ist mit einer hohen Mortalitätsrate assoziiert.7 Eine Vergiftung verläuft in Phasen: Zeitverzögert innerhalb von 10–24 Stunden nach der Einnahme treten abdominelle Krämpfe, Durchfälle, Übelkeit, Erbrechen und hämorrhagische Enteritiden auf (es ist daher für den Patient:innen wichtig zu wissen, dass bei Durchfall oder Erbrechen das Medikament abzusetzen und ärztliche Hilfe zu suchen ist). 1–7 Tage danach kommt es zu einer schweren Knochenmarksdepression, hämorrhagischen Komplikationen, metabolischen Entgleisungen und Multiorganversagen.8 Die Behandlung ist rein supportiv, Colchicin ist nicht hämodialysierbar, ein spezifisches Antidot existiert noch nicht.
Interaktionen und Kontraindikationen: wichtig für eine sichere Therapie
Colchicin ist ein Substrat des Effluxtransporters P-Glykoprotein (P-gp) und von CYP 3A4.5 Inhibitoren von P-gp oder CYP 3A4 können die Plasmaspiegel von Colchicin relevant beeinflussen und so dessen Toxizität erhöhen. Wechselwirkungen dieser Art sind abhängig von der verordneten Colchicin-Dosis, weiteren verordneten Medikamenten sowie der Leber- und Nierenfunktion des/der Patient:in.1 Die systemische Exposition ist im Einzelfall schwierig vorherzusagen.1 Da gerade Patient:innen mit Gicht oder kardiovaskulären Erkrankungen oft eine umfassende Komedikation aufweisen und Colchicin über eine enge therapeutische Breite verfügt, ist ein Wechselwirkungscheck immer ratsam. Die Überwachung auf klinische Intoxikationssymptome, Kontrollen des Blutbilds und der Nierenparameter verbessern die Sicherheit. Colchicin ist kontraindiziert bei Patient:innen mit Nieren- oder Leberfunktionsstörungen, die gleichzeitig mit einem starken CYP 3A4-Hemmer oder einem P-gp-Inhibitor behandelt werden.5
Weitere Indikationsgebiete
Off-Label findet Colchicin Anwendung bei diversen Erkrankungen – mit hoher Evidenz z. B. beim Morbus Behçet (einer systemischen autoimmunen Entzündung der Blutgefäße) oder dem Dressler-Syndrom, einer Sonderform der Perikarditis.1 Außerdem deutet die Datenlage darauf hin, dass der Wirkstoff bei diversen kardiovaskulären Erkrankungen von Nutzen sein kann (Chronische KHK, Schlaganfall, Vorhofflimmern, akutes Koronarsyndrom).1 Kürzlich erhielt Low-dose Colchicin (Lodoco®) von der amerikanischen FDA eine neue Zulassung – und zwar zur Verringerung des Risikos von Herzinfarkt, Schlaganfall und kardiovaskulärem Tod bei erwachsenen Patient:innen mit atherosklerotischer Erkrankung oder mehreren kardiovaskulären Risikofaktoren. Hintergrund für diesen sekundärpräventiven Einsatz ist der entzündungshemmende Effekt der Substanz im Gefäßendothel. Eine entsprechende Zulassung für den europäischen Markt steht noch aus.9
Quellen
1 Lunzer R, et al.: Colchicine – Phoenix from the ashes. Wien Klin Wochenschr 2025; 137 (Suppl 1), 1–33
2 Hilvert D, et al.: Albert Eschenmoser (1925–2023): A Giant of organic chemistry. Angew Chem Int Ed Engl 2023; 62(49) e202315565
3 BASG Arzneispezialitätenregister, abgerufen am 7. August 2025
4 S3 Leitlinie: Diagnostik und Therapie der Gicht (2024), AWMF Reg. Nr. 060-005
5 Austria Codex Fachinformation
Weitere Literatur auf Anfrage
_Fotostudio_Polsinger_SW.jpg)