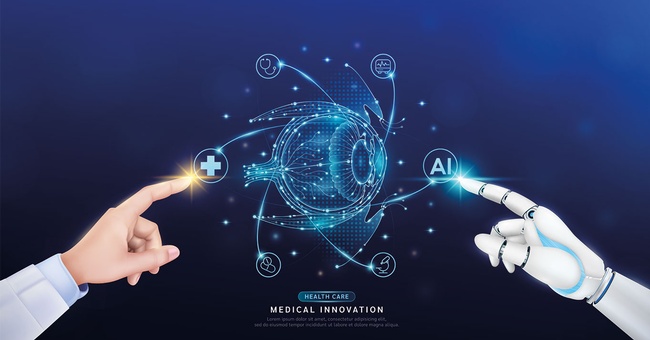Schmerz ist laut IASP (International Association for the Study of Pain) als unangenehme sensorische und emotionale Erfahrung definiert, die mit tatsächlichen oder potenziellen Gewebeschädigungen verbunden ist bzw. diesen ähnelt, und gilt als chronisch, wenn er über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten besteht.
Nach Erwägung und Ausschluss möglicher Erkrankungen wie Arthritis (rheumatisch bedingt), Gicht, Borreliose, Psoriasis-Arthritis, Morbus Bechterew oder Arthritis bei Hämochromatose handelt es sich bei der Generation 50+ oftmals um eine Arthrose (englisch: Osteoarthritis).
Diese ist durch die degenerative Zerstörung des Gelenkknorpels unter enger Einbeziehung der subchondralen Region sowie Beeinträchtigung der angrenzenden Strukturen wie Muskeln, Kapseln und Bänder aufgrund chronischer Fehl- und Überbelastungen definiert.
Die häufig in Knie-, Hüft-, Hand-, Finger- und Wirbelgelenken vorkommenden Arthrosen machen zu Beginn mit Anlaufschmerz, Ermüdungs- und Belastungsschmerz auf sich aufmerksam. Die Erkrankung zeigt Schwankungen in ihrem Verlauf (spontane Verbesserungen bzw. Verschlechterungen möglich) ohne erkennbare Ursache und kann aufgrund äußerlicher Faktoren wie z. B. Kälte oder Nässe mit verstärktem Auftreten von Schmerz einhergehen.
Stadium 1
Verdichtung des Knochengewebes, keine Gelenkspaltschmälerung, keine Osteophyten
Stadium 2
Geringe Gelenkspaltverschmälerung, beginnende Osteophytenbildung, angedeutete Unregelmäßigkeit der Gelenkfläche
Stadium 3
Ausgeprägte Osteophytenbildung,
Gelenkspaltverschmälerung, deutliche
Unregelmäßigkeit der Gelenkfläche
Stadium 4
Ausgeprägte Gelenkspaltverschmälerung
bis zur vollständigen Zerstörung, Deformierung/Absterben der Gelenkstrukturen
Knorpelaufbau
Der gesunde hyaline Gelenkknorpel besteht zu 95 % aus einer extrazellulären Matrix mit einem Anteil von 5 % Chondrozyten. Die wenige Millimeter dicke Gewebeschicht besitzt weder Blut- bzw. Lymphgefäße noch Nerven und wird durch Diffusion über die Gelenkflüssigkeit versorgt. Die Struktur der extrazellulären Matrix wird von einem Kollagennetzwerk gebildet, in welches strukturbildende Moleküle eingebettet sind. Dazu zählen vor allem Proteoglykane, welche aufgrund ihrer biophysikalischen Eigenschaften den Schwelldruck sowie die prallelastischen Eigenschaften des Knorpelgewebes gewährleisten sowie zum Teil auch in der Lage sind, selbst Signalkaskaden zu initiieren bzw. andere Signalmoleküle (z. B. Wachstumsfaktoren und Chemokine) zu binden.
Die Eigenschaften der extrazellulären Matrix im Knorpel werden durch die anabolen und katabolen Stoffwechselaktivitäten der Chondrozyten bestimmt, die für Synthese und Abbau der Matrixbestandteile verantwortlich sind.
• Saisonales Obst und Gemüse
• Kräuter und Gewürze: Kurkuma, Chili, Petersilie, Rosmarin, Basilikum, Zimt
• Kieselsäurereiche Lebensmittel: Haferflocken, Hirse, Kartoffeln, Ackerschachtelhalm
• Antioxidantienreiche dunkle Beeren: Brombeeren, schwarze Johannisbeeren, Kirschen
• Nüsse und Samen: Cashewkerne, Leinsamen, Sesam
• Hülsenfrüchte für pflanzliche Proteine: Linsen, Bohnen, Erbsen, Kichererbsen
• Pflanzenöle: Lein-, Raps-, Olivenöl
• Fermentierte Lebensmittel: Sauerkraut, Kimchi, Kombucha, Joghurt
• Wasser, ungesüßter Kräutertee, Grüntee
Pathogenese
(Bio-)Mechanische Veränderungen oder Schädigungen des Knorpels sowie weitere biologische „Stressfaktoren“, welche ein Ungleichgewicht zwischen auf- und abbauenden Prozessen der Chondrozyten entstehen lassen, führen zu einer Veränderung in der Zusammensetzung der Knorpelmatrix. Die oftmalige Folge ist eine kontinuierlich fortschreitende Knorpeldegeneration (z. B. Knorpelerweichung, Knorpeleinrisse bis hin zum kompletten Verlust der Knorpelschicht), wenn die Regenerationskapazität überschritten bzw. erschöpft ist. Spezifische Mediatoren und deren Mechanismen, welche die pathologische Aktivierung der Chondrozyten auslösen, sind nicht abschließend geklärt, jedoch konnten verschiedene Wachstumsfaktoren (z. B. TGFβ, BMPs, FGFs, IGF) sowie inflammatorische Zytokine (z. B. IL-1β) identifiziert werden, welche bei Arthrose in verändertem Maße sowie gestörtem Expressionsmuster vorhanden sind.

Lebensstil oder Gene?
Neben fortgeschrittenem Alter gelten weibliches Geschlecht, genetische Veranlagung (familiäre Häufung), Vorerkrankungen wie Entzündungen, Gelenkverletzungen, anatomische Fehlstellungen von Knie- oder Hüftgelenk sowie Osteoporose zu den biologischen Risikofaktoren, eine Arthrose zu erleiden.
Auch bestimmte Arzneistoffe können Muskelschmerzen auslösen - im folgenden eine Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
• Statine
• Fibrate
• Cyclosporin
• Tacrolimus
• Propofol
• Checkpoint-Inhibitoren
• Chloroquin
• Hydroxychloroquin
• Amiodaron
• Cimetidin
• Penicillamin
• Interferon Alpha
• Colchicin
• Vinchristin
• Antiretrovirale Medikamente
• Finasterid
• Corticosteroide
Achtung bei Kombination: Diese Wirkstoffe (Auswahl) können zusammen mit Statinen
verstärkt Muskelprobleme verursachen:
• Makrolidantibiotika
• Itraconazol, Ketoconazol
• Nefazodon
• Danazol
• Diltiazem
• Verapamil
• HIV-1-Protease-Hemmer
Weiters spielt der individuelle Lebensstil eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung dieser degenerativen Erkrankung. Faktoren wie starkes Übergewicht, (berufliche) Tätigkeiten mit einhergehendem schwerem Heben, häufigem Bücken, Knien oder Hinhocken, gelenkbelastende Sportarten z. B. Ringen, Boxen, Fuß- oder Handball, Bewegungsmangel, langes Sitzen, unzureichende Ausbildung der stabilisierenden Muskulatur und einseitige sowie falsch antrainierte Bewegungsabläufe maximieren zudem das Arthrose-Risiko.
Viel Bewegung hilft viel
Die nichtpharmakologische Therapie besteht neben einer umfassenden Patienteninformation über Krankheitsverlauf, Ernährungsberatung sowie Tipps zur Gewichtsreduktion bei bestehendem Übergewicht vor allem aus der Anleitung zu sinnvoller, angepasster Bewegung mit gezielten, regelmäßig durchgeführten, schonenden Sporteinheiten für Muskelaufbau, Ausdauer sowie generelle Verbesserung der Fitness. Physiotherapeutische Behandlungen, Heil- und Krankengymnastik, Wärme-, Kälte- sowie Wasseranwendungen, spezielle Hilfsmittel (z. B. Gehhilfen, Bandagen, individuell angepasstes Schuhwerk) sowie alternative Behandlungsmethoden (z. B. Akupunktur, Ultraschalltherapie) haben in der Arthrosetherapie einen großen Stellenwert.

Analgetika-Phytotherapeutika-Chondroprotektiva
Analgetika gelten in der Arthrosebehandlung als indiziert, wenn durch Analgesie die regulären körperlichen Aktivitäten beibehalten werden können, wobei die niedrigste zur Schmerzreduktion ausreichende Dosierung über den kürzestmöglichen Zeitraum gewählt werden sollte.
Paracetamol gilt als Mittel der Wahl, weiters haben sich die Vertreter des NSAR-Substanzklasse (Acetylsalicylsäure, Diclofenac, Ibuprofen, Naproxen) in der oralen Therapie bewährt. Auch topische Anwendungen mit Ibuprofen, Diclofenac, Etofenamat, Methylsalicylat und DMSO erweisen sich als hilfreich.
Wirkstoffgruppen wie selektive COX-2-Hemmer, schwache und starke Opioide sowie Glucocorticoide werden ebenfalls zur Behandlung von Arthrose eingesetzt.
Phytotherapeutisch werden innerlich Präparate aus Esche, Pappel, Weihrauch, Curcuma oder Teufelskralle angewendet, während Produkte mit Arnika und Beinwell äußerlich indiziert sind.
Chondroprotektiva wie Hyaluronsäure-Injektionen und die oral zugeführten Substanzen Glucosamin und Chondroitin können gegen Schmerzen sowie Verlust der Funktionsfähigkeit wirksam sein.
Weiters können Arthrose-Patient:innen von der Einnahme des antiinflammatorisch wirkenden Arzneistoffs Diacerein profitieren, welcher positiven Einfluss auf Gelenkschmerzen und die Progredienz der arthrotischen Veränderungen hat.
• Akute Gelenkschmerzen mit Schwellung oder Gelenksteifigkeit unbekannter Genese
• Akute Schmerzen mit starken Begleitsymptomen wie Fieber > 39 °C oder Bewegungseinschränkungen
• Anhaltende Beschwerden > 5 Tage oder wiederholt auftretende Symptome
• Nach Verletzungen, insbesondere bei Verdacht auf Bänderrisse, Frakturen oder
ausgeprägte Hämatome
• Verdacht auf systemische Ursachen (z. B. Gicht, rheumatische Erkrankungen, Infektionen wie Borreliose)
• Im Zusammenhang mit einer ärztlichen Verordnung:
– Unverträglichkeit/Kontraindikation/Nebenwirkungen einer bestehenden Therapie
– Wechselwirkungen: Gleichzeitige Einnahme von anderen Arzneimitteln, Nahrungsergänzungsmitteln
– Therapieversagen: Keine Besserung der Beschwerden trotz Therapie bzw. sogar Verschlechterung
Auch die Muskulatur ist betroffen
Die Arthrose ist auf muskulärer Ebene mit sekundären Muskelpathologien assoziiert, wie etwa struktureller Muskelatrophie oder funktioneller Muskelschwäche. Diese führen zu einer Destabilisierung des bereits vorgeschädigten Gelenks und begünstigen ein rascheres Fortschreiten der Knorpeldegeneration. Begleitende Schmerzen hindern Arthrose-Patient:innen häufig daran, einen erneuten Muskelaufbau anzustreben, wodurch weitere strukturelle Muskelveränderungen wie z. B. Reduktion der Muskelfasern und Verminderung der Gesamtmuskelmasse, verbunden mit funktionellen Einbußen durch die Immobilisation, beobachtet werden können. Andere Ursachen von muskulären Schmerzen, welche als Folge von Anspannung aufgrund körperlicher Überbelastung, in Zusammenhang mit Stoffwechselerkrankungen, hormonellen Veränderungen, Entzündungen, Autoimmunerkrankungen und/oder übermäßigem Alkoholkonsum auftreten können, sind bei Personen der Generation 50+ ebenso in Erwägung zu ziehen.
Quellen
• S3-Leitlinie: Prävention und Therapie der Gonarthrose (2024), AWMF Reg.Nr. 187-050
• Wirth C, et al.: Praxis der Orthopädie und Unfallchirurgie (2014), 3. Auflage, Georg Thieme Verlag, Stuttgart
• Nehrer S, et al.: Möglichkeiten und Grenzen der konservativen Therapie der Arthrose. Der Orthopäde 2021; 50: 346-355
• S1-Leitlinie: Diagnostik und Differenzialdiagnose bei Myalgien (2025), AWMF Reg.Nr. 030-051
• https://www.gesundheit.gv.at/krankheiten/koerper/arthrose/arthrose-symptome-diagnose.html
Weitere Literatur auf Anfrage