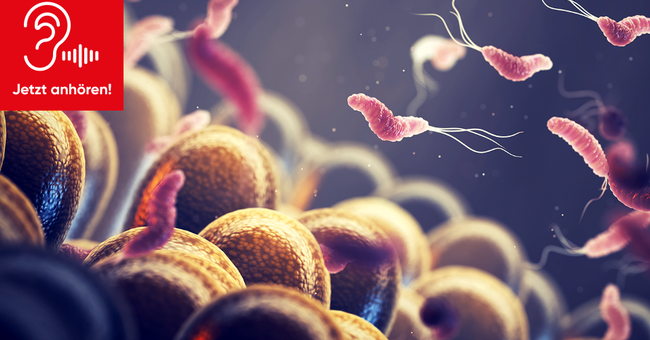Impfungen nehmen eine zentrale Rolle in der Prävention von viralen und bakteriellen Atemwegsinfekten ein. Dies gilt speziell für Risikopersonen wie Ältere, chronisch Kranke und immungeschwächte Menschen, die in dieser Hinsicht als besonders vulnerabel einzustufen sind. Entsprechend hoch ist die Anzahl infektassoziierter Krankenhausaufenthalte und Todesfälle. Umgekehrt können immunisierte Patient:innen schneller und effektiver auf einen Krankheitserreger reagieren, was das Risiko für schwere Verläufe, Hospitalisierungen und Mortalität deutlich reduziert. Die Kontrolle des Impfstatus im Rahmen einer Medikationsanalyse ist daher genauso obligat wie eine strukturierte und systematische Überprüfung verordneter Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel.
Influenza
Influenza ist eine durch Viren verursachte akute Atemwegserkrankung, die saisonal während der Herbst- und Wintermonate bis in den Frühling hinein auftritt. Die Krankheit zeichnet sich durch plötzliches hohes Fieber, Husten, Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen sowie allgemeine Erschöpfung aus. Als Faustregel gilt, dass es bei etwa einem Drittel der Infektionen zu einem fieberhaften, bei einem weiteren Drittel zu einem leichteren und beim letzten Drittel zu einem asymptomatischen Verlauf kommt. Die durchschnittliche Krankheitsdauer liegt bei fünf bis sieben Tagen, kann abhängig von der individuellen Konstitution und etwaigen Risikofaktoren aber auch deutlich länger sein. Die effektivste Präventionsmaßnahme gegen Influenza ist die jährliche Impfung vor Beginn der Saison Mitte Oktober/Anfang November. Zur Verfügung stehen tri- und tetravalente Lebend- bzw. Totimpfstoffe. Für Patient:innen mit schwerer Hühnerei-Allergie sind Impfstoffe aus Zellkulturen erhältlich. Der österreichische Impfplan empfiehlt die Influenzaimpfung für alle Personen ab 60 Jahren und noch nachdrücklicher ab 65 Jahren, schwangere Frauen, Personen mit chronischen Erkrankungen (u. a. Herz-Kreislauf, COPD, Asthma, Diabetes), Kinder ab sechs Monaten sowie Pflegepersonal und Gesundheitsdienstleister:innen, da diese Berufsgruppen einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, sich zu infizieren und das Virus weiterzugeben. Gesunde Erwachsene können sich ebenfalls impfen lassen, insbesondere in Epidemiezeiten oder bei intensivem Kontakt mit Risikogruppen. Trotz des umfangreichen Angebots sterben jedes Jahr viele Österreicher:innen an den Folgen von Influenza – die meisten ungeimpft.
Influenzaimpfung kann noch mehr
Häufigste Todesursache bei schwerem Krankheitsverlauf sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie ein akutes Koronarsyndrom oder die Dekompensation einer bestehenden Herzinsuffizienz. Es ist daher nachvollziehbar, dass eine Impfung die Rate kardiovaskulär bedingter Todesfälle bei Influenza vermindert. In den letzten Jahren verdichteten sich jedoch die Hinweise, wonach die kardioprotektive Wirkung unabhängig von einer tatsächlichen Infektion ist. Mittlerweile ist die Evidenz derartig überzeugend, dass die Europäische Gesellschaft für Kardiologie (ESC) bei kardiovaskulären Risikopatient:innen eine Klasse-IA-Empfehlung für die jährliche Influenzaimpfung ausspricht. Der zugrunde liegende Mechanismus ist bislang unbekannt. Diskutiert werden plaquestabilisierende Effekte, ein Rückgang der systemischen Inflammation und eine verminderte thrombogene Aktivität.
Die Metaanalyse von Behrouzi et al. mit über 9.000 Patient:innen errechnet eine Risikoreduktion von 34 % für schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse – bei kürzlich aufgetretenem akuten Koronarsyndrom sogar um 45 %. Die Number Needed to Vaccinate (NNV) liegt bei 23 für ein kardiovaskuläres Ereignis und bei 36 für einen kardiovaskulären Todesfall. Die IAMI-Studie randomisierte hospitalisierte Patient:innen mit akutem Koronarsyndrom innerhalb von 72 Stunden nach Koronarangiographie/perkutaner Koronarintervention bzw. Hospitalisierung auf eine Influenzaimpfung oder Placebo. Patient:innen in der Impfgruppe profitierten von einer signifikanten Reduktion des primären kombinierten Endpunkts, bestehend aus Gesamtmortalität, Myokardinfarkt oder Stent-Thrombose.
MacIntyre et al. sahen sich die Effektstärke der Influenzaimpfung an und verglichen sie mit anerkannten medikamentösen und nichtmedikamentösen Präventionsstrategien. Demzufolge bewegt sich die präventive Wirkung in derselben Größenordnung wie Antihypertensiva, Statine und Rauchstopp. Die Ergebnisse wurden rezent von einer unabhängigen Forschungsgruppe der ESC bestätigt. Hochdosierte tetravalente Influenzaimpfstoffe dürften im Hinblick auf die kardiovaskuläre Prophylaxe normaldosierten Impfstoffen überlegen sein. Dies gilt besonders für Patient:innen ≥ 65 Jahren.
Keuchhusten
Keuchhusten (Pertussis) ist eine meldepflichtige, durch Tröpfcheninfektion übertragene bakterielle Erkrankung mit dem gramnegativen Erreger Bordetella pertussis. Sie verläuft in drei Stadien. Im Stadium catarrhale kommt es nach einer Inkubationszeit von etwa ein bis drei Wochen zu erkältungsähnlichen Symptomen. Das Stadium convulsivum ist von heftigen, anfallsartigen Hustenattacken charakterisiert, bevor diese über mehrere Monate im Stadium decrementi allmählich abklingen. Der langwierige Verlauf, selbst wenn die betroffene Person nicht mehr ansteckend ist, hat Pertussis den Namen „Krankheit der 100 Tage“ eingebracht. Mögliche Komplikationen wie Apnoe, Sekundärinfektionen und akutes Atemnotsyndrom treten vor allem bei Säuglingen und ungeimpften Kindern auf. Bei Geimpften und Erwachsenen präsentiert sich Pertussis als andauernder Husten ohne die klassischen Begleiterscheinungen.
Aktuelle Daten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zeigen, dass sowohl das Erkrankungsalter als auch die Prävalenz von Pertussis in Österreich deutlich zugenommen haben. Waren es im Jahr 2015 österreichweit noch 579 Fälle, wurden 2023 2.791 und 2024 12.143 Fälle gemeldet. Erklärungen für den sprunghaften Anstieg vermuten ein verändertes Erregerreservoir sowie eine verminderte Pertussis-Immunität durch versäumte Auffrischungsimpfungen. Darauf deuten zumindest die hohen Krankheitszahlen bei Kindern und Jugendlichen zwischen zehn und 19 Jahren hin.
Infolgedessen adaptierte das nationale Impfgremium das frühere Impfschema. Nach der bisher üblichen 2+1-Basisimmunisierung im 3., 5. und 11./12. Lebensmonat folgt die erste Auffrischungsimpfung ab dem vollendeten 5. Lebensjahr im Zuge der Diphtherie-Tetanus-Poliomyelitis-
Pertussis-Vierfachimpfung. Die zweite wird nach weiteren fünf Jahren verabreicht. Alle weiteren Pertussisimpfungen erfolgen dann ebenfalls in 5-jährigen (früher 10-jährigen) Abständen mit dem Dreifach-Impfstoff Diphtherie-Tetanus-Pertussis. Zum Schutz von Neugeborenen und Säuglingen in den ersten Lebenswochen wird eine maternale Immunisierung im 3. Trimenon zwischen der 27. und 36. Schwangerschaftswoche empfohlen, unabhängig vom Zeitpunkt der letzten Pertussisimpfung.
RSV
Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) ist ein weltweit verbreitetes Virus, das akute Infektionen der unteren und oberen Atemwege verursacht. Es gehört zur Familie der Paramyxoviren und wird hauptsächlich durch Tröpfcheninfektion – etwa beim Husten oder Niesen – sowie durch direkten Kontakt mit kontaminierten Oberflächen übertragen. Fast alle Kinder infizieren sich bis zum Ende des zweiten Lebensjahres mindestens einmal mit RSV. Der schlecht vorhersehbare Krankheitsverlauf macht es schwierig, banale Infekte von lebensbedrohlichen Infektionen der unteren Atemwege (LRTI) zu trennen, die eine intensivmedizinische Betreuung erfordern. Dies trägt gerade bei Säuglingen zu einer erheblichen Mortalitäts- und Morbiditätsbelastung in den ersten Lebensmonaten bei, die anschließend abnimmt und ab einem Alter von etwa 60 Jahren U-förmig wieder ansteigt.
Zum passiven Schutz vor RSV gab es lange Zeit nur den monoklonalen Antikörper Palivizumab, der Risikokindern monatlich über die gesamte RSV-Saison verabreicht werden muss. Seit Dezember 2024 befindet sich der monoklonale Antikörper Nirsevimab im Kinderimpfprogramm des Bundes, der Bundesländer und der Sozialversicherung und wird kostenfrei in ganz Österreich angeboten. Nirsevimab ist zugelassen zur Prävention von RSV-bedingten LRTI bei allen Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern während ihrer ersten RSV-Saison sowie Kindern im Alter von bis zu 24 Monaten, die während ihrer zweiten RSV-Saison weiterhin anfällig für eine schwere RSV-Erkrankung sind. Kinder, die innerhalb der RSV-Saison vom 1. Oktober bis 31. März geboren sind, werden in der ersten Lebenswoche vor Entlassung aus dem Krankenhaus immunisiert, jene außerhalb der Saison vom 1. April bis 30. September bei niedergelassenen Kinderärzt:innen.
Ergänzend zu Nirsevimab sind drei weitere RSV-Impfstoffe für Erwachsene erhältlich: Ein adjuvantierter Subunit-Impfstoff für Personen über 50 Jahren mit erhöhtem Risiko für eine RSV-Erkrankung und Personen ab 60 Jahren, ein mRNA-basierter Impfstoff für Personen ab 60 Jahren und ein bivalenter, nicht-adjuvantierter Subunit-Impfstoff zur Impfung von Schwangeren in der 24. bis 36. Schwangerschaftswoche zum passiven Nestschutz für ihre Kinder in der ersten RSV-Saison. Letzterer hat kürzlich eine Zulassungserweiterung für Personen ab 60 Jahren erhalten. Das therapeutische Armamentarium ist also gut gefüllt.