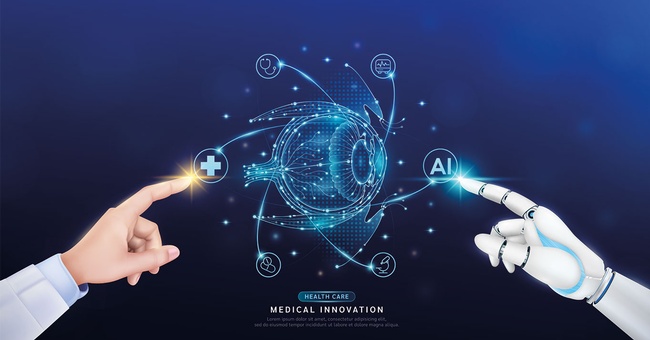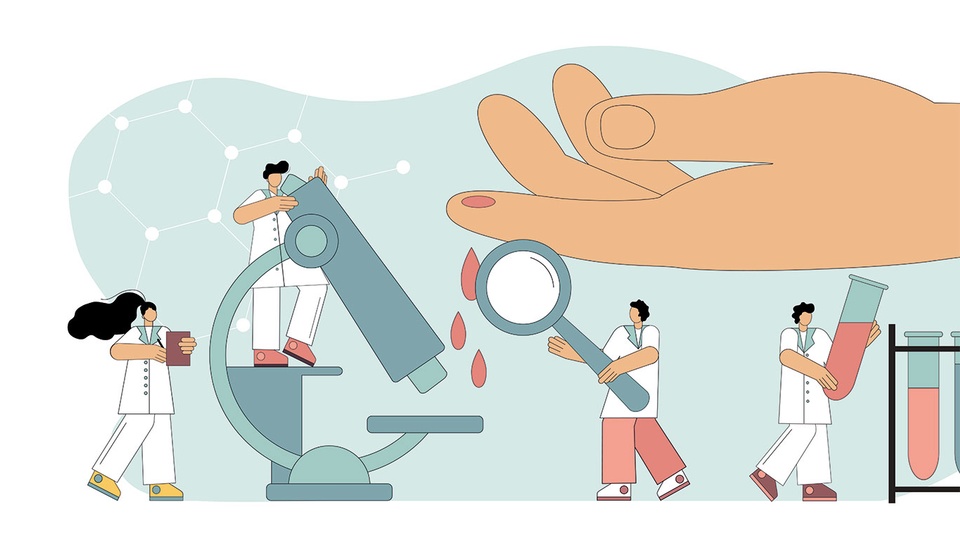
Zahlreiche Studien zeigen Assoziationen zwischen den Serumkonzentrationen von 25-Hydroxy-Vitamin-D und einer Vielzahl häufiger Erkrankungen, darunter muskuloskelettale, metabolische, kardiovaskuläre, maligne, autoimmunbedingte sowie infektiöse Krankheitsbilder.1 Auch wenn ein kausaler Zusammenhang zwischen den 25(OH)D-Spiegeln und vielen dieser Erkrankungen bislang nicht eindeutig belegt ist, haben diese beobachteten Zusammenhänge zu einer weit verbreiteten Supplementierung mit Vitamin D sowie zu einem deutlichen Anstieg der Labordiagnostik von 25(OH)D in der Allgemeinbevölkerung geführt. Die Nutzen-Risiko-Abwägung dieser Entwicklung ist bislang nicht abschließend geklärt. Ebenso besteht weiterhin Unsicherheit hinsichtlich der optimalen Zufuhrmenge von Vitamin D sowie der Rolle der 25(OH)D-Testung im Rahmen der Krankheitsprävention.1
Prävention durch Diagnostik – der Stellenwert von Vitamin D
Ein ausreichend hoher Vitamin-D-Spiegel ist essenziell für die Regulation des Calcium- und Phosphathaushalts sowie für den Erhalt einer gesunden Knochenstruktur. Besonders im Kindesalter sowie nach der Menopause ist eine ausreichende Versorgung unerlässlich, um Erkrankungen wie Rachitis, Osteomalazie oder Osteoporose vorzubeugen. Auch wenn über den potenziellen Nutzen einer weiterführenden Supplementierung in anderen Bereichen – etwa Immunsystem oder Herz-Kreislauf – noch diskutiert wird, sind sich Fachkreise in einem Punkt einig: Die Kenntnis des individuellen Vitamin-D-Spiegels bildet die Grundlage für jede gezielte Therapie oder Präventionsmaßnahme. Denn laut Leitlinien wird eine empirische Supplementierung, also die Einnahme von Vitamin-D-Präparaten ohne Kenntnis des 25(OH)D-Spiegels, im Erwachsenenalter bis 75 Jahre nicht empfohlen.1
Gerade weil Symptome eines Mangels oft unspezifisch oder zunächst unauffällig verlaufen, gewinnt die niederschwellige Diagnostik an Bedeutung. Hier setzt der neue Trend zur patientennahen Labordiagnostik (Point-of-Care-Testing, POCT) in Apotheken an: Schnelltests ermöglichen eine unkomplizierte, schmerzfreie und zuverlässige Messung des Vitamin-D-Spiegels – ohne lange Wartezeiten oder Labortermine. Denn auch ein Zuviel an Vitamin D kann schädliche Folgen wie Herzrhythmusstörungen oder Hyperkalzämie mit sich ziehen. Deshalb ist eine Vitamin-D-Messung immer wichtig, um nicht wahllos zu supplementieren. Als fettlösliches Vitamin kann Vitamin D nämlich in Fett und Muskelgewebe gespeichert werden.
Wer profitiert von einer Vitamin-D-Testung in der Apotheke?
Die Haut produziert unter Sonneneinwirkung den Großteil unseres Vitamin-D-Bedarfs – typischerweise 80–90 %. Nur ein kleiner Anteil von 10–20 % wird über die Ernährung aufgenommen. In Mitteleuropa ist diese wichtige Eigenproduktion allerdings auf die Sommermonate beschränkt.
Mit zunehmendem Alter nimmt die körpereigene Produktion von Vitamin D ab – ein Effekt, der unter anderem mit der altersbedingten Abnahme der Hautdicke in Zusammenhang steht. Daher spielt die Supplementierung insbesondere in der Geriatrie eine zentrale Rolle. Zu den Risikogruppen für eine Unterversorgung zählen darüber hinaus Personen mit geringer Sonnenexposition, etwa chronisch Kranke, Patient:innen unter bestimmten medikamentösen Therapien sowie Menschen mit dunkler Hautfarbe, da eine höhere Hautpigmentierung die körpereigene Vitamin-D-Synthese hemmt.2
In diesen Fällen kann eine regelmäßige Kontrolle durch Schnelltests helfen, einen Mangel frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Auch unterliegt der Vitamin-D-Spiegel saisonalen Schwankungen und eine einmalige Messung muss nicht zwingend aussagekräftig für den Vitamin-D-Status sein.2 Die Kapillarblutentnahme aus der Fingerbeere erfolgt rasch und unkompliziert und ist insbesondere auch für Menschen mit Nadelangst eine zugängliche Alternative zur venösen Blutabnahme. Apotheken bieten für diese diagnostischen Maßnahmen ideale Voraussetzungen: lange Öffnungszeiten, kein Termindruck, wohnortnahe Versorgung und die fachliche Kompetenz, direkt im Anschluss an die Messung individuelle Empfehlungen zur Supplementierung zu geben.
POCT-Technologie: zuverlässig und anwenderfreundlich
Die aktuell verfügbaren Point-of-Care-Vitamin-D-Schnelltests beruhen in der Regel auf immunologischen Testverfahren. Dabei kann entweder Kapillarblut oder Serum als Ausgangsmaterial dienen. Die Tests liefern quantitative Ergebnisse innerhalb weniger Minuten und ermöglichen so nicht nur die Initialdiagnostik, sondern auch Verlaufskontrollen im Rahmen einer bestehenden Therapie. Wichtig ist: Auch wenn Schnelltests in Apotheken klassischer Labordiagnostik in puncto Komplexität nicht gleichkommen, erreichen sie eine hohe Präzision. Vergleichsstudien zeigen eine solide Korrelation zu etablierten Methoden wie ELISA oder HPLC. Die Durchführung ist standardisiert, IVDR (In-vitro-Diagnostika-Verordnung)-konform und in nahezu jeder Apotheke problemlos umsetzbar.3
Welche Supplementierung wird empfohlen?
Der Vitamin-D-Status wird durch die Messung von 25-Hydroxy-Vitamin-D bestimmt – einem Vorläufer des aktiven Vitamin D. Die Werte werden in nmol/l oder ng/ml angegeben. Das Expertengremium empfiehlt eine empirische Vitamin-D-Supplementierung für Kinder und Jugendliche im Alter von 1 bis 18 Jahren, für Erwachsene über 75 Jahre, Schwangere sowie Personen mit einem hohen Risiko für Prädiabetes. Angesichts des begrenzten Angebots an natürlichen Lebensmitteln mit hohem Vitamin-D-Gehalt sollte die Supplementierung durch eine Kombination aus angereicherten Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln erfolgen. Aufgrund fehlender belastbarer Daten aus klinischen Studien spricht sich das Gremium gegen eine routinemäßige Bestimmung des 25(OH)D-Spiegels aus, sofern keine eindeutige medizinische Indikation vorliegt. Diese Empfehlungen sollen die derzeit gültigen Referenzwerte für die Vitamin-D-Zufuhr nicht ersetzen und gelten nicht für Personen mit bereits bestehender Indikation zur Vitamin-D-Therapie oder -Diagnostik. Weitere Forschung ist notwendig, um den optimalen 25(OH)D-Spiegel in Bezug auf den spezifischen gesundheitlichen Nutzen festzulegen.1
Laut der AWMF-Leitlinie werden 500 I.E. Vitamin D pro Tag für Kinder im ersten Lebensjahr und bei ausschließlich gestillten Säuglingen mindestens bis zum zweiten Lebensjahr empfohlen.4
Gesetzliche Grundlagen und Zukunftsperspektiven
Seit der jüngsten Novellierung des Apothekengesetzes ist es Apotheken in Österreich möglich, standardisierte diagnostische Schnelltests – inklusive Kapillarblutentnahme – eigenverantwortlich durchzuführen. Diese Entwicklung stellt einen wichtigen Schritt zur Stärkung der Rolle der Apotheke in der Primärversorgung dar. Durch den direkten Patientenkontakt, kurze Wege und das Vertrauen in die pharmazeutische Beratung kann die Apotheke nicht nur zur Prävention beitragen, sondern auch als Monitoringstelle für die langfristige Therapiekontrolle fungieren.
Umrechnung der Messwerte:
1 ng/ml = 2,5 nmol/l
Umrechnung der Dosierung:
1 µg Vitamin D = 40 I.E.
Vitamin-D-Schnelltests in Apotheken bieten eine wertvolle Ergänzung der bestehenden Gesundheitsversorgung: einfach, schnell, patientennah und zuverlässig. Sie ermöglichen individuelle Diagnostik und schaffen die Basis für eine gezielte Supplementierung. Regelmäßige Tests könnten dabei helfen, die Wirksamkeit von Therapien zu überprüfen und eine Über- oder Unterdosierung zu vermeiden. Damit leisten Apotheken nicht nur einen Beitrag zur Prävention, sondern stärken auch ihre Position als erste Anlaufstelle in Gesundheitsfragen – mit Potenzial für deutlich mehr.
Quellen
1 Demay MB, et al.: Vitamin D for the prevention of disease: an endocrine society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2024; 109(8): 1907-1947.
2 Hintzpeter B, et al.: Higher prevalence of vitamin D deficiency is associated with immigrant background among children and adolescents in Germany. J Nutr 2008; 138(8):1482-1490.
3 Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and
repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU (Text with EEA relevance).
4 S1-Leitlinie: Vitamin-D-Mangel-Rachitis (2022), AWMF-Register Nr.174-007.