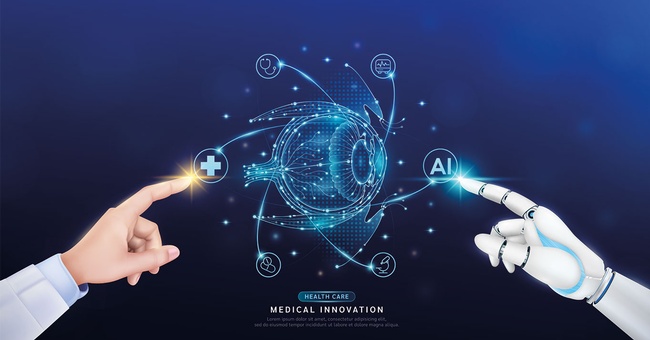Die biologische Frau ist im Durchschnitt 36 Jahre ihres Lebens fruchtbar. Ihre reproduktive Lebensspanne beginnt mit dem Einsetzen der Menstruation, der sogenannten Menarche, in einem Alter von 8,5 bis 13 Jahren und dauert bis zur Menopause, welche als das Ausbleiben der Ovulation über ein Jahr hinweg definiert ist und in einem Alter von etwa 51 Jahren eintritt. Durchschnittlich dauert der weibliche Zyklus einer jungen, gesunden Frau mit nachgewiesener Fertilität 28 Tage, beginnend mit dem ersten Tag der Periode. Diese dauert in der Regel drei bis sechs Tage an und ist gefolgt von der sogenannten Follikelphase. In dieser Phase kommt es zur Reifung eines Follikels im Eierstock, aus welchem während des Eisprungs an etwa Tag 14 des Zyklus eine Eizelle freigesetzt wird. Erfolgt keine Befruchtung der Eizelle, folgt die sogenannte Lutealphase, die häufig von prämenstruellen Symptomen geprägt ist.
PMS und PMDS
Das prämenstruelle Syndrom (PMS) sowie die prämenstruelle dysphorische Störung (PMDS) erscheinen in der zweiten Zyklushälfte (Lutealphase), also der Zeitspanne zwischen Ovulation und dem Beginn der Menstruation. Ihr klinisches Bild reicht von Verhaltensänderungen wie Müdigkeit, Schlafstörungen, Heißhunger und Fressattacken bis hin zu schwerwiegenderen psychischen Erscheinungen wie verstärkte Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen und depressive Verstimmung. Zu den dabei auftretenden körperlichen Beschwerden zählen häufig Brustspannen, ein Blähbauch sowie Kopf- und Unterleibsschmerzen. Bei PMDS handelt es sich um eine besonders schwere Form von PMS, bei der die Betroffenen besonders unter den psychischen Symptomen leiden, die sowohl ihren sozialen als auch beruflichen Alltag stark beeinträchtigen können. Weiters können sich im Zuge dieser Krankheitsbilder bereits vorhandene Erkrankungen wie Migräne, das Reizdarmsyndrom oder auch Hypothyreose verstärkt äußern.
Ursache und Entstehung des PMS und der PMDS sind bis heute nicht genau geklärt. Sie sind durch eine Vielzahl von Faktoren bedingt, u. a. der Sensitivität des zentralen Nervensystems (ZNS) der betroffenen Frauen auf zyklusbedingte Hormonschwankungen im weiblichen Körper.
HIER GEHTS ZUR FORTBILDUNG
Die Rolle von Allopregnanolon
Besonders bedeutsam sind in diesem Zusammenhang Progesteron und sein Hauptmetabolit Allopregnanolon. Das Neurosteroid Allopregnanolon ist ein positiver Modulator des GABA-A-Rezeptors im ZNS und verstärkt damit die inhibierende GABA-Wirkung. Während die Progesteron- und damit auch die Allopregnanolon-Konzentration in der Lutealphase ansteigt, ist sie während der Menstruation und in der Follikelphase gering. Es wird daher vermutet, dass die starke Abnahme des Allopregnanolon-Spiegels am Zyklusende das physiologische GABA-Glutamat-Gleichgewicht stört, was die Entstehung von PMS und PMDS begünstigen könnte. Auch Östrogen und sein Einfluss auf die serotonerge Aktivität im Gehirn spielen eine Rolle: An PMS und PMDS leidende Frauen weisen spezifische Serotonin-Anomalien auf. Diese werden besonders in der späten Lutealphase deutlich, wenn das Östrogenlevel abgenommen hat. Der daraus resultierende Serotonin-Mangel könnte die für PMS und PMDS typischen depressionsähnlichen Symptome, Heißhungerattacken und Konzentrationsschwierigkeiten erklären. Zusätzlich werden während der Lutealphase höhere Prolaktinkonzentrationen beobachtet, was ebenfalls mit PMS-Symptomen assoziiert wird. Weitere Einflussfaktoren können psychosoziale Umstände wie Stress, ein dysreguliertes Immunsystem sowie eine genetische Prädisposition darstellen.
Dysmenorrhoe
Unter Dysmenorrhoe wird eine schmerzhafte Menstruationsblutung verstanden. Dabei wird zwischen der primären und der sekundären Dysmenorrhoe unterschieden. Frauen, die unter einer primären Dysmenorrhoe leiden, verfügen in der Regel über eine normale Beckenanatomie. Als Ursache der primären Dysmenorrhoe wird eine erhöhte Prostaglandin-Sekretion im Uterus während der Menstruation vermutet, die eine Kontraktion der Gebärmutter mit sich bringt und damit zu krampfartigen Schmerzen im Unterleib führt. Besonders junge Frauen, die noch nie ein Kind geboren haben, sowie untergewichtige Frauen sind von primären Dysmenorrhoen betroffen. Auch die Lebensweise hinsichtlich Ernährung, Bewegung und Schlafdauer sowie -qualität spielt eine bedeutende Rolle im Zusammenhang mit schmerzhaften Regelblutungen. Bei einer sekundären Dysmenorrhoe sind die Schmerzen auf Anomalien im Fortpflanzungsapparat zurückzuführen, wobei Endometriose eine häufige Ursache darstellt.
Beschwerdefreier Zyklus – Lebensstilmaßnahmen
Für zahlreiche Frauen stellen das prämenstruelle Syndrom und die prämenstruelle dysphorische Störung eine große Belastung und Einschränkung im Alltag dar. Dysmenorrhoe zählt zu den häufigsten Ursachen für das Fernbleiben junger Mädchen und Frauen von Schule oder Arbeit. Ein besonders wichtiger Punkt, um eine Linderung der Symptome zu erreichen, ist der Lebensstil. Alltägliche Gewohnheiten wie Rauchen, Alkoholkonsum oder der häufige Verzehr von Junkfood können zu einer Verstärkung der Beschwerden führen, während eine gesunde Lebensweise mit ausgewogener, nährstoffreicher Ernährung, Sport und Hygiene des Schlaf-Wach-Rhythmus das Beschwerdebild deutlich verbessern kann. Beispielsweise zeigte eine Querschnittsstudie mit Fragebögen an jugendlichen Mädchen in Garhwal, Indien, dass ein direkter Zusammenhang zwischen Ernährung und körperlicher Aktivität und Menstruationsstörungen wie PMS, Dysmenorrhoe und unregelmäßigem Menstruationszyklus besteht. Dabei konnte festgestellt werden, dass Mädchen, die regelmäßig Fast Food konsumierten, häufiger zu PMS neigten und vor allem deutlich öfter an einer Dysmenorrhoe litten als jene mit seltenerem Junkfood-Konsum. Grund dafür dürfte der Einfluss der im Fast Food enthaltenen gesättigten Fettsäuren auf den Progesteronmetabolismus sein.
• Alter < 30 Jahre
• Nulliparität
• Untergewicht und Gewichtsverlust
• Mangelnde Schlafqualität, langes Aufbleiben,
Schlafdauer < 7–8 Stunden
• Kälteexposition und Verzehr von kalten oder scharfen Speisen und Lebensmitteln während der Menstruation
• Stress und negative Emotionen während der Menstruation
• Unregelmäßige Menstruationszyklen
• Dysmenorrhoe in der Familienvorgeschichte
• Rauchen und Alkoholkonsum
Eine weitere Studie aus dem Jahr 2020 bestätigte, dass das Auslassen des Frühstücks und Diäten in der Vergangenheit ein häufigeres Auftreten von Menstruationsstörungen sowie Schmerzen während der Menstruation mit sich bringen. Sowohl in Bezug auf PMS und PMDS als auch auf Dysmenorrhoe profitieren betroffene Frauen von regelmäßiger körperlicher Aktivität. Die Verbesserung der PMS- und Dysmenorrhoe-Symptome durch Bewegung und Sport ist wohl auf den dadurch verstärkten Blutfluss und die vermehrte Ausschüttung von Endorphinen zurückzuführen. Typische Beschwerden wie Schmerzen, Depression und Angst können infolgedessen abnehmen. Auch lokale Wärme in Form von Wärmepads oder -pflastern können bei Krämpfen im Unterleib Abhilfe schaffen.

Symptomlinderung durch Phytotherapie
PMS/PMDS: Mönchspfeffer
Die Verwendung der Extrakte aus Mönchspfefferfrüchten (Vitex agnus-castus L.) zur Behandlung von prämenstruellen Symptomen ist weit verbreitet. Sowohl in vitro als auch in Tierversuchen zeigten Inhaltsstoffe des Mönchspfeffers eine Bindung an Typ2-Dopamin-Rezeptoren und damit eine Hemmung der Prolaktin-Freisetzung. Ein häufiges Symptom von PMS stellt die sogenannte Mastodynie dar, also Schmerzen und Spannen der Brust. Es wird vermutet, dass dies auf einen erhöhten Prolaktin-Spiegel in der Lutealphase zurückzuführen ist, welcher durch die dopaminergen Substanzen im Mönchspfeffer herabgesetzt und damit das Brustspannen vermindert werden kann. Aber auch in Bezug auf weitere sowohl körperliche als auch psychische Symptome von PMS und PMDS konnte unter Therapie mit Mönchspfefferextrakten eine Verbesserung festgestellt werden. Beispielsweise könnte die hohe Affinität des Mönchspfeffers zu bestimmten Opiat-Rezeptoren Grund für seine schmerzreduzierende und stimmungsaufhellende Wirkung sein. Die besten Effekte dürften mit der einmal täglichen Einnahme von 20 mg eines 60%igen ethanolischen Extraktes erzielt werden. Eine Dosissteigerung auf 30 mg erbrachte in Studien keinen besseren Effekt. Auch die Gabe anderer pflanzlicher Trockenextrakte wie Johanniskraut (Hypericum perforatum L.) oder Safran (Crocus sativus L.) sowie die Einnahme verschiedener Nahrungsergänzungsmittel wie Magnesium, Kalzium oder Myo-Inositol kann sich bei PMS und PMDS als wirksam erweisen.
Primäre Dysmenorrhoe: Schafgarbe
Seit hunderten von Jahren findet die Schafgarbe (Achillea millefolium L.) Verwendung in der Volksmedizin zahlreicher Länder. Aufgrund seiner entzündungshemmenden und spasmolytischen Eigenschaften wird Schafgarbenkraut traditionell zur Behandlung entzündlicher Ekzeme, bei gastrointestinalen Beschwerden und bei schmerzhaften Krampfzuständen im Unterleib eingesetzt. Eine im Jahr 2015 veröffentlichte, im Iran durchgeführte Studie bestätigte die Wirksamkeit der Schafgarbe bei primärer Dysmenorrhoe. In dieser randomisierten doppelblinden Placebo-kontrollierten Studie wurden Teebeutel mit 4 g Schafgarbenblütenpulver (Versuchsgruppe) oder 4 g Stärke (Placebo) verwendet. Die Probandinnen sollten über einen Zeitraum von zwei Menstruationszyklen in den ersten drei Tagen ihrer Monatsblutung pro Tag drei Teetassen zu je 300 ml trinken. Bei der mit Schafgarbe behandelten Versuchsgruppe konnte ein und zwei Monate nach Beginn der Therapie eine Verbesserung der Symptome nachgewiesen werden. Zudem traten keine Nebenwirkungen auf.

Medikamentöse Therapie
NSAR: First-line-Therapie bei primärer Dysmenorrhoe
Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) wie Ibuprofen oder Naproxen sind das Mittel erster Wahl zur Behandlung einer primären Dysmenorrhoe. NSAR sind Hemmer der Cyclooxygenase (COX) und damit der Prostaglandin-Synthese. Dadurch wird einerseits die schmerzhafte Kontraktion der Gebärmutter reduziert, auf der anderen Seite wirken NSAR im zentralen Nervensystem direkt analgetisch. Die Literatur berichtet von einem zusätzlichen Vorteil der NSAR durch Reduktion starker Men-struationsblutungen. Idealerweise sollte die Therapie damit ein bis zwei Tage vor Beginn der Periode gestartet und in regelmäßigen Einnahmeabständen während der ersten zwei bis drei Tage der Menstruation fortgeführt werden. Trotz der bekannten Wirksamkeit der NSAR bei primärer Dysmenorrhoe berichten etwa 20 % der Patientinnen minimale bis keine Erleichterung durch die Einnahme. Grund dafür könnte sein, dass nicht die richtige Dosis eingenommen wird oder Schwankungen im Zyklus das richtige Timing der Behandlung erschweren. Die durch NSAR hervorgerufenen gastrointestinalen Nebenwirkungen schränken ihren Gebrauch zum Teil ein, die Einnahme empfiehlt sich daher mit einer Mahlzeit.
Hormontherapie
Neben der Gabe von NSAR ist die Verschreibung kombinierter oraler Kontrazeptiva eine gebräuchliche Therapie, die sowohl bei primärer Dysmenorrhoe als auch bei PMS und PMDS eingesetzt wird. Durch Ovulationshemmung und damit Unterdrückung der zyklusabhängigen Hormonschwankungen im Blut werden PMS- und PMDS-Symptome gelindert. Weiters verursachen eingesetztes Östrogen und Gestagen eine Verminderung der Gebärmutterschleimhautdicke sowie eine Reduktion von COX-2 und der Prostaglandine, was zu einer Verbesserung der Schmerzen im Zuge einer primären Dysmenorrhoe führt. Kombinierte orale Kontrazeptiva können häufig auch starke Menstruationsblutungen abschwächen, Akne und Hirsutismus verbessern sowie die Knochendichte erhöhen. Bei Kontraindikationen gegen Östrogen können alternativ auch reine Gestagenpillen eingesetzt werden. Aufgrund zahlreicher möglicher Nebenwirkungen wie Übelkeit, Kopfschmerzen und Gewichtszunahme sollten Ärzt:innen gemeinsam mit den Patientinnen das Nutzen-Risiko-Verhältnis abwägen.
Psychotroper Therapieansatz bei PMS und PMDS
Zur Behandlung des PMS und seiner schwersten Form, der PMDS, haben sich auch selektive Serotonin-Reuptake-Inhibitoren (SSRI) und selektive Noradrenalin-Reuptake-Inhibitoren (SNRI) als effektiv erwiesen. Hierbei werden allerdings anders als bei einer Depression nur sehr geringe Dosen des Medikaments eingenommen. Weiters wird lediglich eine zyklische Therapie durchgeführt, beginnend mit der Einnahme kurz vor dem Eisprung bis hin zum Beginn der Periode.
Quellen
1 Nuriyeva R, et al.: Prämenstruelles Syndrom (PMS) und prämenstruelle dysphorische Störung (PMDS). J Gynäkol Endorkrinol CH 2022, 25: 13-18
2 Wang L, et al.: Prevalence and risk factors of primary dysmenorrhea in students: a meta-analysis. Value in Health 2022; 25(10): 1678-1684
3 McKenna KA, et al.: Dysmenorrhea. Am Fam Physician 2021; 104(2): 164-170
4 Jenabi E, et al.: Effect of achillea millefolium on relief of primary dysmenorrhea: a double-blind randomized clinical trial.
J Pediatr Adolesc Gynecol 2015; 28(5): 402-404
5 French L: Dysmenorrhea. Am Fam Physician 2005; 71(2): 285-291
Weitere Literatur auf Anfrage