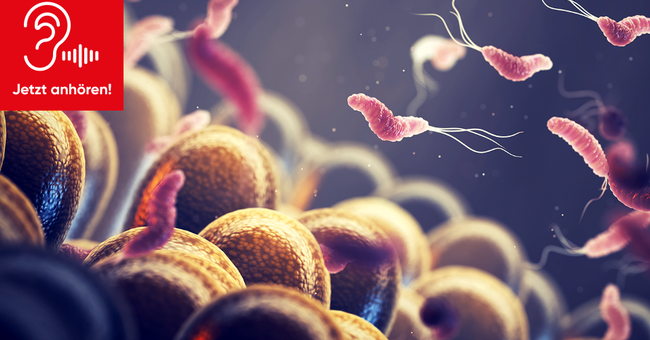Schmerzen gehören zu den häufigsten gesundheitlichen Beschwerden. Als „unangenehme sensible und emotionale Erfahrung verbunden mit einem tatsächlichen oder potenziellen Gewebeschaden“ beeinflussen sie uns körperlich und emotional. Diese duale Natur erklärt, wieso schmerzhafte Situationen so gut im Gedächtnis bleiben. Unabhängig von ihrer Ursache beeinträchtigen Schmerzen die Lebensqualität erheblich. Alltägliche Aktivitäten werden zur Belastung, Schlaf und Wohlbefinden leiden und das soziale Leben kann stark eingeschränkt sein. Viele Betroffene zögern zunächst, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Oft beginnt der erste Schritt zur Linderung in der Apotheke. Als niedrigschwellige Anlaufstelle bietet sie kompetente Beratung und Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Schmerzmittel und weiterführender Maßnahmen.
HIER GEHTS ZUR FORTBILDUNG
Akut versus chronisch
Akute Schmerzen sind plötzlich und vorübergehend. Sie korrelieren fast immer mit einem auslösenden Ereignis, etwa wenn man auf eine heiße Herdplatte greift oder einschießende Rückenschmerzen beim Runterbücken verspürt. Schmerzen, die länger als drei Monate andauern, werden als chronisch bezeichnet. Die eigentliche Alarmfunktion geht dabei verloren und der Schmerz wird zur eigenständigen Erkrankung. Sozialer Rückzug und körperliche Inaktivität sind bei Patient:innen mit chronischen Schmerzen ebenso verbreitet wie Depression und ein geringes Selbstwertgefühl.
Schmerz ist nicht gleich Schmerz
Anhand ihrer Ursache werden Schmerzen einer von drei mechanistischen Kategorien zugeteilt. Die auch als „Entzündungsschmerz“ bekannten nozizeptiven Schmerzen treten in aller Regel nach einer Gewebeverletzung auf. Sie werden je nach Lokalisation als dumpf, drückend, krampf- oder kolikartig beschrieben und beruhen auf der Aktivierung von Schmerzrezeptoren durch Botenstoffe (z. B. Prostaglandine). Beim neuropathischen Schmerz werden Nerven geschädigt, sei es durch Verletzungen oder schlecht eingestellten Diabetes. Der Schmerz äußert sich dann nicht am Ort der Läsion, sondern in dem Areal, das der entsprechende Nerv innerviert. Typisch sind brennende, stechende oder elektrisierende Schmerzen, die mit Missempfindungen wie Taubheitsgefühl und Ameisenlaufen einhergehen können. Bei noziplastischen Schmerzen liegt keine klare körperliche Ursache vor. Vielmehr wird die Entstehung auf eine veränderte zentrale Schmerzwahrnehmung und -verarbeitung zurückgeführt (z. B. somatoforme Störungen). Von gemischten Schmerzen spricht man dann, wenn sich mehrere Schmerzarten überschneiden (z. B. Tumorschmerzen).
Zielgerichtet behandeln
Idealerweise orientiert sich die medikamentöse Behandlung an der vorliegenden Schmerzart. Schmerzmediziner:innen bezeichnen dies als mechanismenbasierte Therapie. Wenngleich in der Apotheke keine ausführliche Schmerzdiagnostik möglich ist, so kann man sich mit einigen einfachen Fragen einen guten Überblick verschaffen: Wie lange haben Sie schon Schmerzen? Sind die Schmerzen bei einer bestimmten Bewegung oder Tätigkeit aufgetreten? Fühlen Sie sich schwummrig oder haben Sie das Gefühl, sich setzen zu müssen? Haben Sie eine chronische Grunderkrankung? Gibt es Dauermedikamente, die Sie regelmäßig einnehmen? Wichtige Warnsignale, die eine sofortige ärztliche Abklärung notwendig machen und einer Selbstmedikation nur in Ausnahmefällen zugänglich sind, nennt der Kasten zu den Red Flags.
Werkzeugkiste der Apotheker:innen
Apotheker:innen können auf ein breites Spektrum an rezeptfreien Schmerzmitteln zurückgreifen. Dazu gehören pflanzliche und synthetische Medikamente, topische und orale. Hinzu kommen unterschiedliche Darreichungsformen, die eine patientenindividuelle Auswahl ermöglichen.
Paracetamol – der Alleskönner
Es gibt kaum ein Schmerzbild in der Selbstmedikation, bei dem Paracetamol nicht zum Einsatz kommt. Als Vertreter der nichtsauren Antipyretika hat es schmerzstillende und fiebersenkende, jedoch keine entzündungshemmende Wirkung. Das ist auch der Grund, wieso Paracetamol bei Kopfschmerzen meist hilft, bei entzündlichen Schmerzen des Bewegungsapparats hingegen nicht. Diese Erkenntnis spiegelt sich auch in den Empfehlungen diverser Fachgesellschaften wider, z. B. der aktuellen Leitlinie für das Management unspezifischer Rückenschmerzen, die von der Behandlung mit Paracetamol explizit abrät. Von Vorteil ist, dass Paracetamol bei Patient:innen eingesetzt werden kann, für die nicht-steroidale Antirheumatika (NSAR) keine Option sind.
Acetylsalicylsäure (ASS) – altbewährt
ASS hält gleich zwei Rekorde: Es ist das älteste halbsynthetische Schmerzmittel und hemmt von allen NSAR die Thrombozytenaggregation am stärksten. Ersteres hat zu seiner bis heute andauernden Bekanntheit geführt, letzteres macht man sich in der Kardiologie zunutze. Für die Schmerztherapie ist der thrombozytenaggregationshemmende Effekt allerdings unerwünscht, da er die Rate gastrointestinaler Nebenwirkungen und Blutungen verglichen zu anderen NSAR erhöht. ASS darf deshalb nicht vor und nach Operationen oder bei Schmerzen nach zahnärztlichen Eingriffen verwendet werden. Bei Kindern unter zwölf Jahren ist es generell kontraindiziert (Reye-Syndrom). Die Anwendung bei rheumatischen Beschwerden ist heute obsolet, weil die entzündungshemmende Wirkung erst bei Tages-dosen über 4.000 mg auftritt.
• Plötzlicher, sehr starker Schmerz
• Fieber, Nachtschweiß, ungewollter Gewichtsverlust
• Neurologische Ausfälle, Lähmungen, Gangunsicherheit, Doppelbilder
• Bewusstseinsstörungen, Verwirrtheit
• Schmerzen bei immunsupprimierten Patient:innen
• Schmerzen trotz adäquater Therapie oder zunehmender Schmerz
• Neuropathische Schmerzen
• Chronische Schmerzen
(Dex-)Ibuprofen – der Allrounder
Ibuprofen bzw. dessen rechtsdrehendes Enantiomer Dexibuprofen zeichnet ihre schmerz-, fieber- und entzündungshemmende Wirkung aus. Die gastrointestinale Verträglichkeit ist besser als jene von ASS, hinsichtlich der Blutgerinnung verhält es sich neutral. Aufgrund dieser vorteilhaften Eigenschaften hat Ibuprofen einen festen Platz in den Apothekenregalen inne und gehört zu den beliebtesten OTC-Schmerzmitteln. Vorsicht ist bei Patient:innen geboten, die niedrigdosiertes ASS zur kardiovaskulären Prophylaxe erhalten. Ibuprofen besetzt die Bindungsstelle von ASS und kann dessen thrombozytenaggregationshemmende Wirkung abschwächen. Ähnliche Interaktionen wurden auch für andere Arylpropionsäurederivate wie Naproxen und Dex-ketoprofen beschrieben.
Naproxen und Dexketoprofen – interessantes Duo
Studien zeigen, dass Naproxen von allen NSAR das geringste kardiovaskuläre Risiko zeigt. Das macht es zum Mittel der Wahl bei schmerzgeplagten Herz-Kreislauf-Patient:innen, die für eine Selbstmedikation infrage kommen. Angesichts der langen Halbwertszeit von 12 bis 15 Stunden werden unter Naproxen gastrointestinale Nebenwirkungen häufiger beobachtet als bei anderen NSAR. Dafür reicht eine zweimal tägliche Einnahme aus, was u. a. bei Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises oder Menstruationsbeschwerden vorteilhaft ist.
Dexketoprofen ist ein vergleichsweise neues NSAR im OTC-Sortiment. Das Racemat (R,S)-Ketoprofen unterliegt nach wie vor der Rezeptpflicht. Hinsichtlich Wirkung und möglicher Nebenwirkungen verhält sich Dexketoprofen sehr ähnlich zu Ibuprofen. Studien haben gezeigt, dass (Dex-)Ketoprofen bei Schmerzen, die mit rheumatoider Arthritis verbunden sind, womöglich eine stärkere schmerzlindernde Wirkung als Ibuprofen haben könnte.
Phenazon und Propyphenazon – gern übersehen
Phenazon und Propyphenazon sind Pyrazolon-Abkömmlinge und werden wie Paracetamol zu den nichtsauren Antipyretika gerechnet. Als solche haben sie schmerz- und fiebersenkende Eigenschaften. Eine Besonderheit der Pyrazolone ist ihre krampflösende (spasmolytische) Wirkung an der glatten Muskulatur, was sich bei Migräne oder krampfartigen abdominellen Beschwerden therapeutisch nutzen lässt. Ihre gastrointestinale Verträglichkeit ist mit Paracetamol vergleichbar, kardiovaskuläre Nebenwirkungen wurden bisher nicht beschrieben, dafür Überempfindlichkeitsreaktionen und in Einzelfällen eine Schädigung von Knochenmarkszellen (Agranulozytose).
Butylscopolamin – wirksam bei Krämpfen
Butylscopolamin(iumbromid) ist ein quartärer Arzneistoff aus der Gruppe der Parasympatholytika. Es wirkt krampflösend und entspannt die Muskeln des Magen-Darm-Trakts, der Gallenwege und des Urogenitaltrakts, indem es muskarinische Acetylcholin-Rezeptoren blockiert. Infolge der positiven Ladung wird Butylscopolamin bei oraler und rektaler Gabe schlecht absorbiert, hat eine niedrige Bioverfügbarkeit und gelangt kaum ins Gehirn. Dadurch ist das Risiko für zentrale anticholinerge Nebenwirkungen gering. Periphere Nebenwirkungen wie Mundtrockenheit, Verstopfung und Harnverhalt sind vor der Abgabe zu berücksichtigen.
Zolmitriptan – der Neue
Zolmitriptan – das erste in Österreich rezeptfrei verfügbare Triptan – ist ein selektiver 5-HT1B/-1D-Rezeptoragonist und wird zur akuten Behandlung von Migräneattacken mit oder ohne Aura eingesetzt. Es kontrahiert dilatierte intrakranielle Blutgefäße und hemmt die Freisetzung vasoaktiver Neuropeptide im trigeminovaskulären System, was die Migränesymptomatik lindert. Zolmitriptan wirkt bei oraler Gabe nach circa 45 Minuten. Bei unzureichendem Ansprechen kann nach frühestens zwei Stunden eine zweite Dosis eingenommen werden. Die Tageshöchstdosis beträgt zwei Tabletten. Zu den häufigsten Nebenwirkungen zählen Schwindel, Parästhesien, Asthenie, Somnolenz und ein Engegefühl im Brustbereich. Bei Patient:innen mit ischämischen Herz-Kreislauf-Krankheiten sowie unkontrollierter Hypertonie sind Triptane kontraindiziert.
Schmerzsalben und -pflaster
Der Markt an lokal wirksamen Schmerzmitteln ist groß und ständigen Veränderungen unterworfen. Zu den etablierten Arzneistoffen gehören:
• Ätherische Öle: Kampfer, Kiefernadelöl, Terpentinöl, Eukalyptusöl
• Pflanzliche Extrakte: Arnika, Beinwell, Rosmarin
• Rubefazienzien: Benzylnicotinat, Menthol, Methylsalicylat, Capsaicin
• NSAR: Etofenamat, Indometacin, Diclofenac, Ibuprofen
Ihr Einsatz lohnt sich insbesondere in Situationen, bei denen eine gezielte, örtlich begrenzte Schmerzlinderung gewünscht ist. Das beinhaltet sowohl Zerrungen, Muskelverspannungen, Prellungen und Sportverletzungen als auch Finger- und Kniegelenksarthrose.
Quellen
• Austria Codex. Unter: https://austria-codex.at/. Letzter Zugriff: 28.06.2025
• Fachinformation der jeweiligen Präparate. Unter: www.basg.gv.at. Letzter Zugriff: 28.06.2025
• Geisslinger G, et al.: Mutschler Arzneimittelwirkungen - Pharmakologie, Klinische Pharmakologie, Toxikologie, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 11. Auflage, 2020
• Karow T, et al.: Allgemeine und Spezielle Pharmakologie und Toxikologie, Thomas Karow Verlag, 29. Auflage, 2021
• Peterlin BL, et al.: Clinical pharmacology of the serotonin receptor agonist, zolmitriptan. Exp opin drug metabol toxicol 2007; 3(6), 899–911