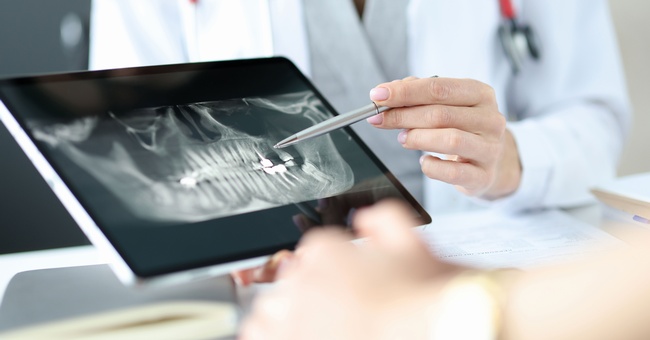Zahlreiche Arzneimittel, die zur Behandlung systemischer Erkrankungen eingesetzt werden, können unerwartet einen erheblichen Einfluss auf die Mundgesundheit haben.
rale Nebenwirkungen werden häufig nicht mit der Medikation in Verbindung gebracht, wodurch die eigentliche Ursache übersehen wird. Dies erschwert das rechtzeitige Erkennen und eine gezielte Therapie. Deshalb ist es wichtig, Patient:innen bereits bei der Abgabe von Arzneimitteln, die sich auf die Mundgesundheit auswirken können, entsprechend zu sensibilisieren und über mögliche orale Nebenwirkungen aufzuklären. Ebenso entscheidend ist es, auftretende Beschwerden frühzeitig als potenzielle uner-wünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) zu identifizieren und nicht ausschließlich symptomatisch zu behandeln. So lassen sich Risiken für die Mundgesundheit reduzieren und die Therapietreue nachhaltig stärken.
Zahnverfärbungen
Zahnverfärbungen stellen nicht nur ein ästhetisches, sondern auch ein klinisch relevantes Problem dar. Die Lebensqualität und das Selbstbewusstsein der Patient:innen können erheblich beeinträchtigt werden. Neben der Mundhygiene, bestimmten Lebensmitteln und Tabak spielen verschiedene Arzneimittel eine bedeutende Rolle. Dabei können sowohl systemisch verabreichte Medikamente als auch lokal wirksame Präparate Verfärbungen der Zähne hervorrufen. Man unterscheidet zwischen intrinsischen Verfärbungen, die im Zahninneren entstehen und irreversibel sind, und extrinsischen Verfärbungen, die nur die Zahnoberfläche betreffen und meist reversibel sind.
Ein klassisches Beispiel für erstere sind durch Tetrazykline hervorgerufene Verfärbungen. Sie binden während der Zahnentwicklung irreversibel an Calcium im Dentin und Schmelz und führen so zu fleckigen gelblich-grauen bis bräunlichen Verfärbungen. Typischerweise sind alle Zähne betroffen und die Verfärbung ist nicht reversibel. Da die ersten acht Lebensjahre einen besonders sensiblen Entwicklungszeitraum für die Zahnentwicklung darstellen, sollten Tetrazykline in der Schwangerschaft, Stillzeit und frühen Kindheit nicht eingesetzt werden.
Auch Fluoride, die für die Kariesprophylaxe unverzichtbar sind, bergen bei Überexposition während der Zahnentwicklung ein Risiko. Während die zweimal tägliche Anwendung fluoridhaltiger Zahnpasta laut Leitlinien empfohlen wird, kann ein übermäßiger Fluoridgehalt in den ersten acht Lebensjahren zu Dentalfluorosen führen.2 Durch das überschüssige Fluorid wird die Mineralisation des Zahnschmelzes gestört und es kommt zur Hypomineralisation. Diese manifestiert sich durch kreidig-weiße, opake Flecken oder Streifen, die im Schweregrad variieren können. Bei ausgeprägteren Formen treten bräunliche Verfärbungen, poröser Schmelz mit rauer Oberfläche bis hin zu Substanzverlust auf, wodurch restaurative Maßnahmen wie Füllungen erforderlich werden können.
Neben systemisch wirksamen Medikamenten sind auch lokale Therapeutika relevant. Mundspüllösungen mit dem Antiseptikum Chlorhexidin werden häufig bei Entzündungen im Mundraum eingesetzt, können jedoch ab einer gewissen Konzentration bei zu langer Anwendung zu extrinsischen braunen Belägen führen. Diese entstehen durch Wechselwirkungen mit Nahrungsfarbstoffen aus beispielsweise Kaffee, Tee oder Rotwein. Im Gegensatz zu den intrinsischen Verfärbungen sind diese jedoch reversibel und lassen sich durch eine professionelle Mundhygiene entfernen. Ähnliches gilt für nikotinhaltige Ersatzpräparate wie Kaugummis oder Lutschtabletten. Hier oxidiert das Nikotin zu gelblichen Ablagerungen, die die Zahnoberfläche verfärben können.3
Zahnfleischveränderungen durch Arzneimittel
Eine Gingivahyperplasie, also eine Zahnfleischwucherung, kann als Nebenwirkung bestimmter Arzneimittel auftreten. Häufig betroffen sind Patient:innen unter einer Therapie mit Antiepileptika wie Phenytoin, Immunsuppressiva wie Ciclosporin A und Antihypertensiva wie Calciumkanalblockern, wobei Nifedipin als klassisches Beispiel gilt. Aber auch häufig verschriebene ACE-Hemmer und Angiotensin-1-Rezeptorantagonisten können gingivale Wucherungen auslösen. Typischerweise zeigen sich die Veränderungen der Mundschleimhaut bereits in den ersten drei Monaten nach Beginn der medikamentösen Therapie.
Die Entstehung einer Gingivahyperplasie ist grundsätzlich multifaktoriell und wird insbesondere durch chronische Entzündungen begünstigt. Eine unzureichende Mundhygiene spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Deshalb sollten Patient:innen, die mit den genannten Medikamenten therapiert werden, regelmäßig zahnmedizinisch betreut werden. Ratsam ist außerdem, bereits vor Therapiebeginn mit einer potenziell risikobehafteten Medikation für das Zahnfleisch die individuelle häusliche Mundhygiene zu optimieren, die Mundgesundheit zu stabilisieren und bestehende Entzündungen zu behandeln.1
Klinisch zeigt sich die Gingivahyperplasie durch eine Schwellung der Gingiva rund um die Zähne. Die Schleimhaut wird empfindlicher und blutet leichter. Dies erschwert die tägliche Mundhygiene, fördert die bakterielle Plaquebildung und erhöht damit auch das Kariesrisiko.
Dysbiose der Mundflora
Der Großteil der über 600 Bakterienarten in unserem Mund sind harmlose und nützliche Mikroorganismen. Diese helfen der Mundflora, sich vor pathogenen Bakterien zu schützen. Ein gesundes orales Milieu vermag den Biofilm und das Keimspektrum auf der Zunge und im Mund zu regulieren. Durch die Einnahme von Antibiotika oder stark antiseptischen Mundspülungen kann diese Flora aus dem Gleichgewicht geraten und pathogene Mikroorganismen haben dann ein leichtes Spiel. Deshalb ist es ratsam, nach einer derartigen Therapie probiotische Bakterien für die Mundflora einzunehmen, die in Form von Kau- oder Lutschtabletten verfügbar sind.
Xerostomie
Durch bestimmte Medikamente wie bspw. Antihypertensiva, Antihistaminika, Anticholinergika, Psychopharmaka (Neuroleptika, Antidepressiva, Schlafmittel), starke Schmerzmittel sowie Diuretika kann die Speichelproduktion abnehmen, was zu Mundtrockenheit (Xerostomie) führt.
Besonders kritisch wird es, wenn diese Arzneimittel von älteren Patient:innen eingenommen werden, da im Alter die Speichelproduktion ohnehin abnimmt. Generell ist etwa die Hälfte der über 65-Jährigen von Mundtrockenheit betroffen. Der Speichel nimmt jedoch eine wichtige Rolle für unsere Mundgesundheit ein und ist für die Mundhygiene essenziell. Er ist zu einem gewissen Grad für die Selbstreinigung des Mundraumes und die Selbstregulation der Mundflora zuständig. Zusätzlich kann er Säuren neutralisieren und somit den Zahnschmelz schützen. Durch Mundtrockenheit kann daher das Kariesrisiko steigen oder es können Schleimhautreizungen bis hin zu Entzündungen der Speicheldrüsen entstehen. Auch eine Beeinträchtigung des Geschmackssinns kann Folge der Mundtrockenheit sein. Darüber hinaus spielt der Speichel auch eine wichtige Rolle bei der Verdauung. Er enthält das Enzym α-Amylase, das bereits im Mund mit dem Kohlenhydrat-Abbau beginnt. Dadurch können die entstehenden kleineren Bestandteile im weiteren Verdauungsprozess besser verwertet werden. Da ein trockener Mund nicht nur unangenehm, sondern auch ein Nährboden für die Vermehrung von Bakterien ist, ist eine Behandlung wichtig. Zur Anregung des Speichelflusses können Hausmittel wie das Lutschen von Zitronen, Eiswürfeln oder Bonbons zur Anwendung kommen. Auch eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist essenziell. Alternativ sind spezielle Speichelersatzmittel, Glycerin-Sticks, Xylit-Kaugummi und salzhaltige Zahnpasten hilfreich. Kann die Mundtrockenheit nicht in den Griff bekommen werden, sollte nach Möglichkeit eine Medikationsanpassung vorgenommen werden.
Asthmatiker:innen als Risikopatient:innen
Die Verwendung cortisonhaltiger Inhalatoren kann neben Mundtrockenheit das Risiko für orale Pilzerkrankungen, insbesondere Mundsoor, erhöhen. Nach der Inhalation sollten Patient:innen den Mund gründlich ausspülen, um die Ablagerung von Wirkstoffpartikeln zu vermeiden, die lokal das Immunsystem unterdrücken und die Besiedlung durch Candida-Pilze begünstigen können. Eine langfristige Anwendung kann zudem zu einer Atrophie der Mundschleimhaut führen. Cortison wirkt teilweise auch systemisch und kann die Knochendichte, einschließlich des Kieferknochens, negativ beeinflussen. Auch inhalative Medikamente ohne Glucocorticoide bergen Risiken: Durch enthaltene Zucker wie Lactose kann sich nach unzureichendem Ausspülen Zucker auf Zähnen und Zahnfleisch ablagern, was das Kariesrisiko erhöht. Besonders Kinder mit Asthma, die häufig zusätzlich unter gastroösophagealem Reflux leiden, sind durch die saure Umgebung im Mundraum besonders gefährdet. Aufgrund dieser Risiken sollten Patient:innen mit einer Asthma-Erkrankung eine intensivierte Mundhygiene praktizieren und regelmäßige zahnärztliche Kontrolluntersuchungen wahrnehmen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Geschmacksstörungen
Einige Medikamente können auch zu Geschmacksstörungen führen – entweder zu Dysgeusien,
also einem veränderten Geschmackseindruck, oder zu Hypogeusien, also einer verminderten Geschmackswahrnehmung. In fast der Hälfte der Fälle entwickelt sich zusätzlich eine Xerostomie. Dies kann die Lebensqualität der Patient:innen erheblich beeinträchtigen und im ungünstigsten Fall in einer Mangelernährung münden. Daher ist es wichtig zu wissen, welche Arzneimittel einen Einfluss auf das gustatorische System haben. Häufig werden ACE-Hemmer, Chemotherapeutika und Antibiotika genannt. Auch chlorhexidinhaltige Mundspülungen können kurzfristig zu einer vorübergehenden reversiblen Dysgeusie führen. Die Spülung sollte deshalb ab einer gewissen Konzentration nicht länger als zwei Wochen angewendet werden. Glücklicherweise erholt sich das Geschmackssystem nach Absetzen der ursächlichen Medikation meist schnell wieder.
Medikamenteninduzierte Osteonekrose des Kiefers
Die medikamenteninduzierte Osteonekrose des Kiefers ist eine schwerwiegende, aber seltene Arzneimittelnebenwirkung. Besonders gefährdet sind Patient:innen, die mit Bisphosphonaten, Denosumab oder Angiogenesehemmern behandelt werden, primär im Rahmen von Osteoporose- oder Tumortherapien. Pathophysiologisch spielen eine verminderte Knochenremodellierung, eine eingeschränkte Angiogenese sowie das Vorliegen lokaler Infektionen eine zentrale Rolle. Klinisch äußert sich eine Osteonekrose durch freiliegende, nekrotische Knochen im Kieferbereich und ist häufig von Schmerzen, Schwellung und Sekundärinfektionen begleitet. Zu den wichtigsten Risikofaktoren zählen invasive zahnärztliche Eingriffe wie Extraktionen oder Implantationen, prothetische Druckstellen, eine unzureichende Mundhygiene sowie systemische Begleiterkrankungen und die Einnahme immunsuppressiver Medikamente.
Vor derartigen medikamentösen Therapien ist es daher ratsam, vorab den Kieferstatus beim Zahnarzt erheben zu lassen, da invasive zahnärztliche Eingriffe unter der Therapie ein Risiko darstellen können. Etwaige Zahnsanierungen sollten deshalb vorab abgeschlossen werden. Die Bisphosphonate schaden den Zähnen zwar nicht direkt, können aber schwere Komplikationen verursachen, wenn chirurgische Eingriffe im Mundraum nötig werden. Während der laufenden Medikation sind regelmäßige Kontrollen sowie eine konsequente Mundhygiene unerlässlich. Auch die Früherkennung verdächtiger Symptome stellt eine wichtige Prophylaxemaßnahme dar.
Neue Entwicklungen zeigen, dass insbesondere bei niedrig dosierten Bisphosphonaten in der Osteoporosetherapie implantologische Eingriffe unter strenger Indikationsstellung und engmaschiger Betreuung in Einzelfällen möglich sein können. Dennoch bleibt eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung unerlässlich.
Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Um medikamenteninduzierte Zahnprobleme zu vermeiden beziehungsweise frühzeitig zu erkennen, ist eine enge Abstimmung und Kommunikation zwischen Patient:innen, Hausärzt:innen, Zahnärzt:innen und Apotheker:innen unabdingbar. Jede Fachrichtung kann ihren Beitrag leisten: sei es durch Aufklärung, regelmäßige Kontrolluntersuchungen oder die Optimierung der Mundhygiene. Schlussendlich muss aber immer das Risiko dem Nutzen gegenübergestellt sein, um den Patient:innen die bestmögliche Therapie zu bieten und gleichzeitig die Lebensqualität zu erhalten.
Quellen
1 https://www.quintessence-publishing.com/deu/de/
news/team/-/medikamenten-induzierte-gingivahyperplasien
2 S3-Leitlinie: Kariesprävention bei bleibenden Zähnen –
grundlegende Empfehlungen (2025), AWMF-Reg.Nr. 083-021
3 Wang J, et al.: Drug-induced tooth discoloration: An analysis of the US food and drug administration adverse event reporting system. Front Pharmacol 2023; 14: 1161728