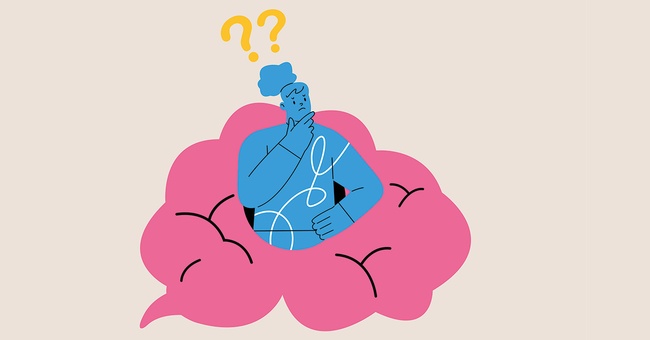Beim metabolischen Syndrom handelt es sich nicht um eine eigenständige Krankheit, sondern um einen Cluster pathophysiologisch zusammenhängender Risikofaktoren. Dazu zählen insbesondere abdominale Adipositas, Insulinresistenz, Hypertonie, Hypertriglyzeridämie und niedriges HDL-Cholesterin. In einer zunehmend überalterten, bewegungsarmen und sich kalorienreich ernährenden Gesellschaft nimmt die Prävalenz kontinuierlich zu – mit schwerwiegenden Konsequenzen für das individuelle Krankheitsrisiko und die Gesundheitssysteme.
Präventive Maßnahmen wie gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung und Aufklärung sind entscheidend, um die Ausbreitung des metabolischen Syndroms einzudämmen.
Diagnosekriterien
Das metabolische Syndrom ist durch das gleichzeitige Vorliegen mehrerer metabolischer Störungen gekennzeichnet. Die häufig verwendete Definition nach der International Diabetes Federation (IDF, 2006) verlangt als zentrales Kriterium die abdominale Adipositas (Taillenumfang ≥ 94 cm bei Männern, ≥ 80 cm bei Frauen, europäische Ethnie) plus zwei der folgenden vier Faktoren:
• Erhöhte Triglyzeride (≥ 150 mg/dl)
• Niedriges HDL-Cholesterin
(< 40 mg/dl bei Männern,
< 50 mg/dl bei Frauen)
• Erhöhter Blutdruck
(≥ 130/85 mmHg)
• Nüchternblutzucker ≥ 100 mg/dl oder Diabetes mellitus
Alternativ werden auch die NCEP-ATP-III- oder WHO-Kriterien verwendet.

Weltweite Prävalenz
Nach aktuellen Schätzungen sind rund ein Drittel der Erwachsenen weltweit vom metabolischen Syndrom betroffen, mit regionalen Unterschieden. In Ländern mit hohem Einkommen liegt die Prävalenz teilweise über 40 % bei Erwachsenen über 60 Jahren.1,2 Auch in Schwellenländern steigt die Rate zunehmend. Besorgniserregend ist auch die Zunahme bei Kindern und Jugendlichen. Eine Metaanalyse zeigt eine globale Prävalenz von 2,8 % bei Kindern und 4,8 % bei Jugendlichen – mit steigender Tendenz.1 Zu den Ursachen zählen hochkalorisch verarbeitete Lebensmittel, Bewegungsmangel, Stress, Schlafmangel, sozioökonomische Faktoren wie Bildungsniveau und Zugang zu gesunder Ernährung, genetische Prädispositionen und intrauterine Einflüsse.
Assoziierte Erkrankungen und Folgekomplikationen
Das metabolische Syndrom erhöht signifikant das Risiko für eine Vielzahl schwerwiegender Erkrankungen. Eine frühzeitige Diagnose und Intervention können helfen, das Risiko für diese Folgeerkrankungen zu verringern. Lebensstiländerungen wie gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung und Gewichtsreduktion sind entscheidend für die Prävention und Behandlung des metabolischen Syndroms. Die wichtigsten assoziierten Krankheitsbilder sind:
Kardiovaskuläre Erkrankungen
Das MetS ist ein starker Prädiktor für arteriosklerotische Erkrankungen. Die Endotheldysfunktion, gesteigerte systemische Entzündungsprozesse und erhöhte Lipidperoxidation fördern Plaquebildung, instabile Atherome und thromboembolische Komplikationen wie Myokardinfarkt und Schlaganfall.
Eine Analyse der Framingham Offspring Study zeigte ein 2- bis 3-fach erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse bei Patient:innen mit MetS.4

Typ-2-Diabetes mellitus
Insulinresistenz ist ein zentrales Merkmal des metabolischen Syndroms und kann unbehandelt zu Typ-2-Diabetes führen. Bis zu 70 % der Menschen mit MetS entwickeln im Laufe der Zeit einen Typ-2-Diabetes.5 Dauerhaft hohe Blutzuckerwerte wirken sich negativ auf Arterien, Nerven und Organe aus und können langfristig zu Komplikationen wie Nierenversagen, Nervenschäden und Sehverlust führen.
Nicht-alkoholische Fettlebererkrankung (NAFLD)
Die Leberverfettung ist eng mit viszeraler Adipositas und Insulinresistenz verknüpft. MetS ist der wichtigste Risikofaktor für NAFLD, welche wiederum zur nicht-alkoholischen Steatohepatitis (NASH), Fibrose und Zirrhose führen kann.
Demenz und kognitive Störungen
Neuere Studien zeigen, dass MetS mit einem um bis zu 14 % erhöhten Risiko für Demenz, insbesondere vaskuläre Demenz, assoziiert ist.6,7 Die chronische Endothelschädigung und neuroinflammatorische Prozesse spielen dabei eine Rolle.
Chronische Nierenerkrankung (CKD)
Hypertonie und Diabetes schädigen die Glomeruli. MetS erhöht das Risiko für CKD um den Faktor 2.8 Wird die Fähigkeit der Nieren beeinträchtigt, Toxine zu entfernen, kann das in fortgeschrittenen Stadien eine Dialyse oder Nierentransplantation erforderlich machen.
Pharmazeut:innen können entscheidend zur Identifikation, Aufklärung und
Therapieadhärenz beitragen, z. B. durch:
• Blutdruck- und Blut-
zucker-Screenings
• Interventionsgespräche
zur Raucherentwöhnung
• Arzneimittelberatung
bei Polypharmazie
• Niedrigschwellige
Gesundheitsförderung
Prävention und therapeutische Ansätze
Lebensstilinterventionen
Die Basis der Therapie bleibt eine multimodale Lebensstiländerung:
• Gewichtsreduktion (mind. 5–10 %)
• Mediterrane oder DASH-Diät
(Dietary Approaches to Stop Hypertension)
• Mindestens 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche
• Nikotinverzicht
• Stressreduktion, gesunder Schlaf
Pharmakologische Intervention
Die medikamentöse Therapie orientiert sich an einzelnen Risikofaktoren:
• Hypertonie
• Dyslipidämie
• Hyperglykämie
• Adipositas
Aktuelle Studienlage
Metabolisches Syndrom und Schlaganfallrisiko
Zahlreiche Studien zeigen einen direkten Zusammenhang von MetS und Schlaganfallrisiko:
• Eine Meta-Analyse von 16 prospektiven Kohortenstudien zeigt: MetS ist mit einem um ca. 70 % erhöhten Risiko für einen neuen Schlaganfall verbunden. Besonders betroffen sind Frauen und das ischämische Stroke-Risiko im Vergleich zu hämorrhagischen Infarkten.
• Die Meta-Analyse zur Relevanz des MetS bei wiederholtem Schlaganfall (7.752 Personen nach Erstereignis) zeigte: Das Re-Risiko war um 52 % höher bei Patient:innen mit MetS. Besonders erhöhter Blutzucker zeigte sich als stärkster einzelner Prädiktor.
• Eine weitere Analyse von 13 Kohortenstudien mit 59.919 Teilnehmer:innen über 60 Jahre zeigte, dass das metabolische Syndrom mit einem erhöhten Risiko für Schlaganfallrezidive und einer höheren Gesamtmortalität verbunden ist. Besonders niedrige HDL-Cholesterinwerte und die Anzahl der Syndromkomponenten waren Risikofaktoren für Rezidive.
Demenz
Es gibt Hinweise darauf, dass das metabolische Syndrom mit neurologischen Erkrankungen wie Alzheimer und anderen Demenzerkrankungen in Verbindung steht. Die genauen Mechanismen sind noch nicht vollständig geklärt, aber Insulinresistenz und Entzündungsprozesse könnten eine Rolle spielen. Zahlreiche Studien belegen diesen Zusammenhang:
• UK Biobank-Studie (2023)
Eine Analyse von über 176.000 Teilnehmern zeigte, dass das metabolische Syndrom mit einem um 14 % erhöhtem Risiko für Demenz verbunden ist. Der Zusammenhang war besonders stark bei Personen mit vier oder fünf der fünf Syndromkomponenten.
• Three-City-Studie
In einer Kohorte von über 7.000 älteren Erwachsenen war das metabolische Syndrom mit einem erhöhten Risiko für vaskuläre Demenz verbunden, jedoch nicht für Alzheimer-Demenz. Ein hoher Triglyceridspiegel war der einzige einzelne Risikofaktor, der mit einem erhöhten Risiko für alle Demenzarten assoziiert war.
• Singapore Longitudinal Ageing Studie
Diese Studie zeigte, dass das metabolische Syndrom sowohl das Risiko für die Entstehung von leichter kognitiver Beeinträchtigung (MCI) als auch für die Progression von MCI zu Demenz erhöht. Besonders Diabetes mellitus und das Vorhandensein von drei oder mehr Syndromkomponenten sind mit einem hohen Risiko verbunden.
• Review-Studie (Acta Neuropsychiatrica)
Eine systematische Übersichtsarbeit ergab, dass das metabolische Syndrom mit einem bis zu doppelt so hohem Risiko für kognitive Beeinträchtigungen und vaskuläre Demenz verbunden ist. Einzelne Komponenten wie Hyperglykämie und Bluthochdruck trugen signifikant zum erhöhten Risiko bei.
Quellen
1 Noubiap JJ, et al.: Global, regional, and country estimates of metabolic syndrome burden in children and adolescents in 2020: a systematic review and modelling analysis.
Lancet Child Adolesc Health 2022; 6(3): 158-170
2 WHO. Obesity and overweight – Fact sheet. www.who.int, abgerufen am 19.7.2025
3 RKI: www.kiggs-studie.de, abgerufen am 19.7.2025
4 Wilson PWF, et al.: Metabolic syndrome as a precursor of cardiovascular disease and type 2 diabetes mellitus. Circulation 2005; 112(20): 3066-3072
5 Ford ES: Risks for all-cause mortality, cardiovascular disease, and diabetes associated with the metabolic syndrome. Diabetes Care 2005; 28(7): 1769-1778
Weitere Literatur auf Anfrage
Sabine_Klimpt.jpg)