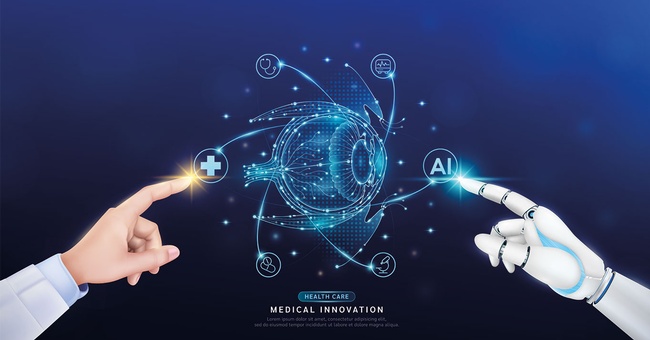Unter dem Begriff Ektoparasiten werden alle Insekten (Flöhe, Läuse und Wanzen) und Spinnentiere (Milben) zusammengefasst, die auf oder in der Haut ihrer Wirte leben. Unterschieden wird anhand der Dauer ihres parasitären Stadiums zwischen permanenten Ektoparasiten wie der Krätzmilbe oder Läusen, deren gesamter Lebenszyklus an den Wirt gebunden ist, und temporären Ektoparasiten wie Wanzen und Flöhen, die den Wirt vorwiegend nur zur Nahrungsaufnahme nutzen. Ein Befall mit Ektoparasiten ist zwar aufgrund von Stichreaktionen wie Juckreiz und Rötungen unangenehm und geht daher oft mit einem hohen Leidensdruck einher, verursacht jedoch in der Regel keine ernsthaften gesundheitlichen Probleme. In Einzelfällen kann es zu Komplikationen durch bakterielle Superinfektionen an der Einstichstelle kommen. Ein zunehmendes Problem stellt jedoch das Übertragen von Krankheitserregern wie Viren, Bakterien oder Parasiten durch deren Speichel oder Kot dar, weshalb ein Befall bestenfalls zu vermeiden oder schnellstmöglich zu behandeln ist. Entgegen vielen Vorurteilen ist ein Befall mit Ektoparasiten jedoch nicht zwangsläufig Ursache mangelnder persönlicher Hygiene.
Läuse
Lausalarm am Ferienende
Der Lausbefall beim Menschen wird als Pediculose bezeichnet und kann durch eine der drei Läusearten auftreten: Kopflaus (Pediculus humanus capitis), Kleiderlaus (Pediculus humanus corporis) und Filzlaus (Pthirus pubis). Aufgrund der hohen hygienischen Standards in Europa haben die Kleiderlaus (Haare, Kleidung und Haut) sowie die Filzlaus (Scham-, Achsel- und Barthaare) vorwiegend bei Menschen auf der Flucht oder ohne festen Wohnsitz Relevanz. Im Gegensatz dazu ist der Befall durch die Kopflaus kein Zeichen mangelnder Hygiene. Die Übertragung erfolgt hauptsächlich durch engen Hautkontakt von Mensch zu Mensch, insbesondere in gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Altenheimen oder Kasernen. Eine indirekte Ansteckung über gemeinsam genutzte Gegenstände wie Kopfbedeckungen, Kissen oder Decken ist selten, eine Übertragung durch Haustiere ausgeschlossen.
Das Laus-Weibchen legt täglich drei bis vier etwa 1 mm große Eier (Nissen) am Haaransatz, aus denen nach ein bis zwei Wochen Nymphen schlüpfen. Diese entwickeln sich über drei Larvenstadien in 18 bis 20 Tagen zu adulten Läusen, die etwa 2 bis 3 mm groß und flügellos sind sowie drei Paar Klammerbeine besitzen, um sich am Haar festzuhalten. Da alle Entwicklungsstadien auf regelmäßige Blutmahlzeiten angewiesen sind und längere Hungerphasen nicht überstehen, beträgt die Überlebensdauer ohne Wirt bei Raumtemperatur nur zwei bis drei Tage.
Tag 1 Erstbehandlung mit Läusemittel und nasses Auskämmen
Tag 2 Nasses Auskämmen
Tag 5 Nasses Auskämmen
Tag 8, 9 oder 10 Wiederholungsbehandlung mit
Läusemittel und nasses Auskämmen
Tag 13 Nasses Auskämmen
Tag 17 Nasses Auskämmen
Der charakteristische Juckreiz auf der Kopfhaut resultiert aus einer lokalen Immunreaktion auf den Speichel der Läuse, der im Rahmen der Blutmahlzeit in die Haut gelangt. Eine Übertragung von Krankheitserregern durch Kopflausbefall ist aktuell nicht beschrieben, jedoch können infolge mechanischer Irritationen durch Kratzen Verkrustungen und ekzematöse Hautveränderungen auftreten.
Die Wiederholungsbehandlung ist ein Muss
Einen Lausbefall erkennt man durch systematische Untersuchung des nassen Kopfhaares auf Läuse und Nissen mithilfe eines feinzackigen Läusekamms, der nach jedem Kämmen auf einem weißen Untergrund abgeklopft wird. Nur bei einem sehr ausgeprägten Befall sind neben dem Kopfhaar auch Augenbrauen, Bart und Achselhaare betroffen. Die Anwendung regulärer Shampoos reicht zur Bekämpfung von Läusen nicht aus. Zur Therapie stehen eine Kombination aus chemischen (Pyrethroide, Neemöl), mechanischen (Kamm) und physikalischen (Dimeticon, Prosil) Behandlungsmethoden zur Auswahl.
Die insektizide Wirkung der physikalischen Methoden beruht auf der Anwendung von Stoffen mit geringer Oberflächenspannung, die in die Atemwege aller Entwicklungsstadien eindringen und Eier von den Haaren lösen.
Die Anwendung erfolgt am trockenen Haar und aufgrund der leicht entzündlichen Eigenschaften unbedingt unter Ausschluss von Hitze (z. B. Fön). Unabhängig vom Wirkmechanismus ist eine Wiederholungsbehandlung nach acht bis zehn Tagen notwendig, um auch nach der Erstbehandlung geschlüpfte Larven abzutöten. Zwischen den Behandlungstagen wird laut Robert Koch-Institut ein regelmäßiges Auskämmen der nassen Haare empfohlen.
Die Einhaltung des Behandlungsplans ist für den Therapieerfolg essenziell. Parallel sollten auch alle engen Kontaktpersonen mitbehandelt, die Umgebung sowie Einrichtungen informiert und einige hygienische Maßnahmen getroffen werden, um eine Neuansteckung zu verhindern: Reinigung von Kämmen, Haarbürsten, -spangen und -gummis mit Seifenlauge, Textilien mit 60 °C waschen, für 24 Stunden bei mindestens –18 °C einfrieren oder drei Tage in Plastikbeuteln aufbewahren (Hungerquarantäne), Teppichböden, Autositze und Möbel absaugen und Beutel gut verschlossen entsorgen.
Flöhe
Haustiere: Ein beliebtes Flohreservoir
Flöhe sind etwa 1 bis 6 mm große, seitlich abgeflachte, flügellose Insekten mit ausgeprägten Hinterbeinen, die sie zu einer Sprungweite von bis zu einem Meter befähigen. Der europaweit am häufigsten parasitierende Floh des Menschen ist der Katzenfloh (Ctenocephalides felis), der als Nestfloh seine Eier vorwiegend in dunklen und trockenen Verstecken ablegt (z. B. Tierkorb) und die Blutmahlzeit am Wirt nur nachts vollzieht. Der Großteil der Flohpopulation, etwa 99 %, befindet sich daher auf Böden, Teppichen und Möbeln.

Die aus den Eiern geschlüpften Larven verpuppen sich nach mehreren Häutungsvorgängen und können in der Puppenhülle einige Monate verweilen, bis die Puppenruhe durch diverse Erschütterungen oder Vibrationen gestört wird und die adulten Flöhe schlüpfen. Die Übertragung auf den Menschen erfolgt häufig über engen Kontakt mit verflohten Haustieren. Der Befall bei Haustieren ist meist im Spätsommer am stärksten und kann neben dem starken Juckreiz und der Unruhe des Tieres auch durch das Bürsten auf einer hellen Oberfläche anhand des dunklen Flohkots erkannt werden. Die Bekämpfung erfolgt durch die Behandlung der Tiere mit geeigneten insektiziden und repellenten Wirkstoffen sowie der sorgfältigen Reinigung des Wohnraumes, insbesondere der Schlafplätze: tägliches Staubsaugen (tägliche Entsorgung der Staubbeutel in gut verschlossenen Plastiksäcken) und Waschen von Textilien mit mindestens 60 °C.
Prophylaxe ist die beste Behandlung
Typische Flohstiche weisen gerötete, stark juckende Papeln auf und liegen häufig mit mehreren Einstichstellen hintereinander auf einer Linie (Flohleiter). Die Behandlung beim Menschen erfolgt durch gründliche Körperreinigung sowie mit der Anwendung von Antihistaminika und Glucocorticoiden. Der Befall an sich stellt kein großes Gesundheitsrisiko dar, problematisch ist jedoch das hohe Übertragungspotenzial von Krankheitserregern (Pest, Flecktyphus, Tularämie) und Bandwürmern, die aber aufgrund der in Mitteleuropa hohen Hygienestandards kaum relevant sind. Die beste Behandlung ist daher eine gute Prophylaxe mit einer lokalen (Halsband, Spot-on) oder oralen Anwendung von Insektiziden und Repellents bei Haustieren, die das Tier selbst und in weiterer Folge den Menschen vor einem Flohbefall schützen. Bei Katzen ist von der Anwendung permethrinhaltiger Produkte abzusehen, da sie den Wirkstoff nicht abbauen können.
Bettwanzen
Die Plage der Tapetenflunder
Die Bettwanze (Cimex lenticularis) ist ein weltweit verbreitetes, braunrotes Insekt mit einer Größe von etwa 4 bis 7 mm. Aufgrund ihrer flügellosen, abgeflachten Körper und der damit einhergehenden Fähigkeit, sich in den engsten Leisten, Möbelstücken und Wandritzen zu verstecken, wird sie auch als „Tapetenflunder“ bezeichnet. Der Lebenszyklus erstreckt sich innerhalb von 14 Monaten vom Ei über verschiedene juvenile Wanzenstadien bis hin zum adulten Tier, das eine kontinuierliche Größenzunahme und fünfmalige Häutung erfordert. Bettwanzen leben in Ansammlungen und verlassen ihre Verstecke vorwiegend nachts für die Blutmahlzeiten. Angelockt werden sie dabei von der Körperwärme ihrer Wirte.

Bettwanzen können jedoch auch monatelang ohne Blutmahlzeit überleben. Als Befallquelle dienen häufig Orte mit hoher Personenfluktuation wie Hotels, Wohnheime, Gemeinschaftseinrichtungen, Flugzeuge und Züge. Die Verbreitung der Parasiten erfolgt dementsprechend durch befallene Möbelstücke, Bücher und häufig auch über das Reisegepäck. Der Nachweis eines Befalls erweist sich jedoch meist als sehr schwierig und ist selten durch frei herumlaufende Bettwanzen zu erkennen. Ein bittermandelartiger, süßlicher Raumgeruch, Kotspuren in Form von schwarzen Punkten, Häutungshüllen sowie charakteristische Stiche in Form einer „Wanzenstraße“ (drei Stiche in einer Linie) geben jedoch gute Hinweise darauf. Ansonsten sind die geröteten Papeln an der Einstichstelle schwer von anderen Insektenstichen zu unterscheiden und können lokal mit antiallergischen oder glucocorticoidhaltigen Lokaltherapeutika behandelt werden.
Eine komplexe Bekämpfungsstrategie
Bei Verdacht auf einen Bettwanzenbefall sollte umgehend eine professionelle Schädlingsbekämpfung über Kammerjäger oder den Entwesungsdienst herangezogen werden.
Befallene Räume und Möbelstücke werden vorwiegend mit langwirksamen Kontaktinsektiziden aus der Gruppe der Pyrethroide, Carbamate und Pyrrole behandelt. Dafür müssen alle potenziellen Verstecke im Raum freigelegt und Möbelstücke auseinander-gebaut werden. Eine Kontrolle erfolgt nach zwei bis drei Wochen. Die Behandlungszyklen werden so lange wiederholt, bis die gesamte Bettwanzenpopulation vernichtet wurde.
Andere Gegenstände wie Bücher oder Kleidung können durch eine Lagerung im Tiefkühler bei mindestens –18 °C für drei Tage, durch Wärmeanwendung für eine Stunde im Ofen, Sauna bei mindestens 55 °C oder Waschen/Trocknen mit 60 °C von Bettwanzen befreit werden.
Auf Reisen sollte das Zimmer vor dem Bezug auf Bettwanzen-Spuren an Bett, Matratze, Steckdosen sowie Wandverkleidungen geprüft werden. Im Anschluss der Reise wird empfohlen, das Reisegepäck zu Hause auf einem weißen Leintuch oder in der Badewanne auszupacken, alle Kleidungsstücke zu waschen und den benutzten Koffer in einem Plastiksack für sechs Monate aufzubewahren, um etwaige mitgebrachte Bettwanzen auszuhungern.