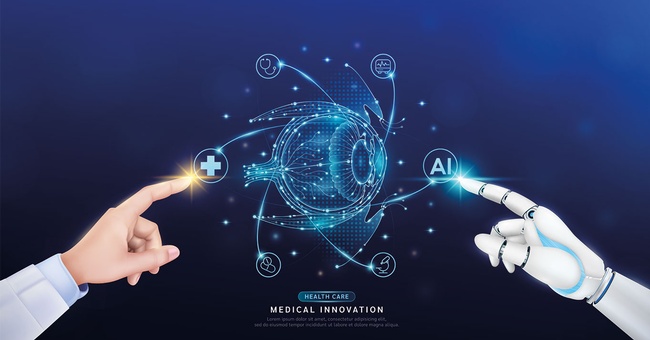Der Gehalt an Gesamtkörpereisen beträgt bei Erwachsenen zwischen 3 und 5 g. Davon befinden sich rund 60 % als Häm-Eisen in den Erythrozyten, während etwa 1 g als mobilisierbares Speichereisen in den Zellen des retikuloendothelialen Systems (RES) von Leber, Milz und Knochenmark vorliegt. Als Transporteisen im Plasma fungieren nur ca. 4 mg, die bis zu 4-mal täglich umgesetzt werden. Generell enthält der männliche Organismus mehr Eisen als der weibliche (55 vs. 44 mg/kg Körpergewicht).
Multitalent Eisen
Zu den wichtigsten Aufgaben von Eisen im menschlichen Körper zählen der Transport und die Speicherung von Sauerstoff in den eisenhaltigen Molekülen Hämoglobin und Myoglobin. Das essenzielle Spurenelement wird im Körper außerdem für die Übertragung von Elektronen innerhalb der Atmungskette zur ATP-Gewinnung und DNA-Synthese sowie für das Zellwachstum genutzt. Eine elementare Rolle spielt das Übergangsmetall für Prozesse wie die angemessene Gehirnentwicklung und Gehirnmorphologie, die neuronale Übertragung, die Myelinisierung sowie die Synthese von Neurotransmittern. Eisen wirkt als Cofaktor verschiedener Enzyme (z. B. Katalase, Peroxidase, Cytochrom-P450-System), die eine Rolle bei intrazellulären Entgiftungs- und Abwehrprozessen spielen. Zudem ist es an grundlegenden Schritten der Synthese von Schilddrüsenhormonen und Kollagen sowie an Prozessen der Immunabwehr beteiligt.
Schweineleber.....................22,1
Kakaopulver.........................10,0
Sojabohnen..........................8,6
Kalbsleber..............................7,9
Linsen......................................7,5
Leberwurst.............................5,3
Haferflocken..........................4,6
Spinat.....................................4,1
Rindfleisch..............................3,2
Geflügel..................................2,6
Angaben in mg/100 g
Wichtige Eisenquellen
Eisen kommt in Lebensmitteln als sogenannte Nichthämsubstanzen (pflanzlich und tierisch) und Hämsubstanzen (tierisch) vor. Die für die Ernährung wesentlichere und besser bioverfügbare Eisenverbindung ist das Protein Häm, in welchem Eisen in seiner zweiwertigen Form das zentrale Atom darstellt. Die Bioverfügbarkeit kann allerdings variieren und wird von verschiedenen Faktoren (z. B. Eisenstatus) beeinflusst. In Pflanzen ist Eisen vorwiegend in der Oxidationsstufe drei zu finden.
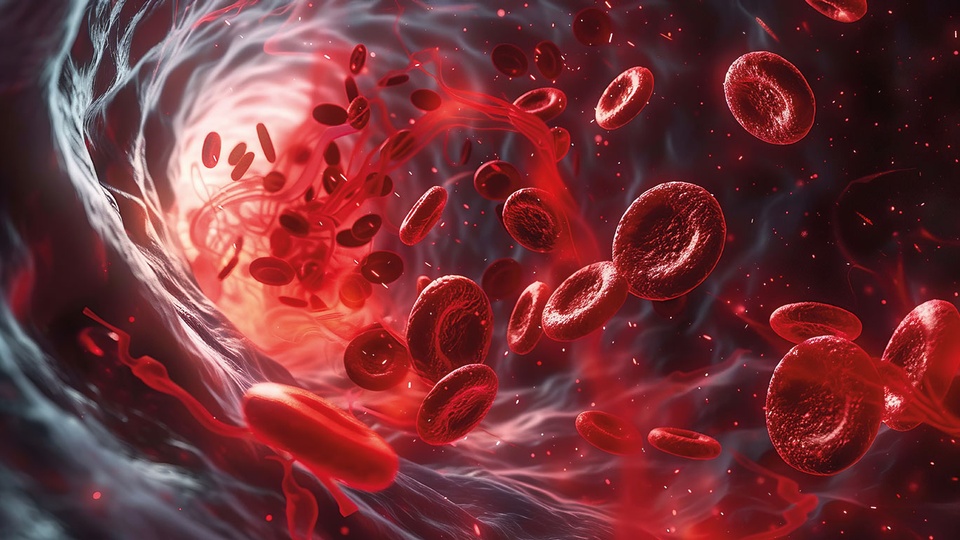
Der Eisenstoffwechsel – ein ausgeklügeltes System
Eisen unterscheidet sich von anderen Mineralstoffen: Das Eisengleichgewicht im menschlichen Körper wird nur durch die Resorption geregelt, da es keinen physiologischen Mechanismus für die Elimination gibt. Von den täglich mit der Nahrung aufgenommenen 15 bis 20 mg Eisen werden im Duodenum und oberen Jejunum durchschnittlich 10–15 % resorbiert, abhängig von Eisenstatus und Zusammensetzung der Mahlzeit; bei Mangel kann die Resorptionsrate deutlich höher liegen. Dreiwertige Eisenionen (Fe3+) müssen zunächst in zweiwertige (Fe2+) reduziert werden, um in die Mukosazelle aufgenommen werden zu können. An der basalen Membran der Darmepithelzelle übernimmt das Protein Ferroportin die Ionen und überträgt diese nach kupferabhängiger Oxidation von Fe2+ in Fe3+ auf das Plasmaprotein Transferrin. Das mit Eisen beladene Transferrin wird anschließend in die Verbraucherzellen des Knochenmarks aufgenommen, wo die Hämoglobinsynthese stattfindet, welche für die Bildung von Erythrozyten essenziell ist. Überschüssige Eisenionen werden an die Speicherform Ferritin gebunden, was die Bildung von toxischen freien Radikalen und den dadurch entstehenden zellulären oxidativen Stress limitiert.
Der tägliche Eisenverlust beträgt ca. 1 mg, erfolgt über Abschuppung von Haut- und Schleimhautzellen und wird mit der Galle bzw. dem Urin ausgeschieden. Während der Menstruation verlieren Frauen im Durchschnitt 15–30 mg Eisen pro Zyklus, was etwa 0,5–1 mg pro Tag entspricht, wobei die individuellen Verluste erheblich variieren können.

Für die Regulation der Eisenhomöostase ist vor allem das in der Leber produzierte Protein Hepcidin verantwortlich, das die Aktivität von Ferroportin reduzieren und somit die Freigabe von Eisen aus den Zellen verhindern kann. Insgesamt resultiert eine verminderte Absorption von Eisen aus der Nahrung und erhöhte intrazelluläre Eisenspeicher. Bei Vorliegen eines Eisenmangels bzw. gesteigerter Erythropoese wird hingegen die Hepcidin-Ausschüttung unterdrückt, was zu einer vermehrten Eisenabsorption aus der Nahrung führt. Entzündungen, Infekte sowie bestimmte genetische Faktoren können ebenso zu einer gesteigerten hepatischen Expression von Hepcidin führen.
Infektanfällig, Kopfschmerzen, Haarausfall?
Wenn die Eisenverluste die Aufnahme längere Zeit übersteigen, entsteht ein absoluter Eisenmangel, der sich durch vielfältige klinische Symptome äußern kann. Dazu zählen Blässe, Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Schwäche, Konzentrationsschwierigkeiten, Kopfschmerzen, Kälteempfindlichkeit, Infektanfälligkeit, Haarausfall, brüchige Nägel, Mundwinkelrhagaden, Wundheilungsstörungen, Wachstumsstörungen bei Kindern sowie Schlafstörungen.
Dysbalance: Bedarf – Verlust – Zufuhr
Die wichtigsten Ursachen für einen Eisenmangel ergeben sich hauptsächlich als Folge von Blutverlust, unzureichender alimentärer Zufuhr oder intestinaler Resorption bzw. erhöhtem Bedarf an Eisen.
Verlust durch Blutungen
• Gynäkologisch: Menstruation, Entbindung
• Gastrointestinal: Refluxösophagitis, Hernien, Ulcera, Polypen, Hämorrhoiden
• Karzinome, chronische Entzündung, Angiodysplasien
• Blutspenden
• Blutabnahme
• Dialyse
• Pulmonale Hämosiderose
• Arzneimittel, die einen okkulten gastrointestinalen Blutverlust provozieren (z. B. NSAR, Antikoagulantien, Thrombozytenaggregationshemmer)
Erhöhter Eisenbedarf
• Kinder unter 5 Jahren
• Adoleszenz
• Schwangerschaft und Stillzeit
• Hochleistungssport
• Chronisch intravasale Hämolyse
Reduzierte Eisenaufnahme
• Inadäquate Ernährung (Diät, Anorexie)
• Chronisch entzündliche Darmerkrankungen
• Atrophische oder Helicobacter pylori-positive Gastritis, Achlorhydrie, Magenresektion, bariatrische Operation
• Malabsorption (Arzneimittel, z. B. PPI), Zöliakie, Morbus Whipple
• Parasitenbefall des Darmes
Als funktioneller Eisenmangel wird der Zustand bezeichnet, bei dem die Eisenspeicher grundsätzlich gefüllt sind, das Spurenelement jedoch ungenügend aus dem RES freigesetzt wird und aufgrund hoher Konzentrationen an Hepcidin im Plasma nicht ausreichend zur Verfügung steht. In der Regel tritt diese Form bei entzündlichen Erkrankungen mit systemischer Immunaktivierung auf. Auch Kombinationen von absoluten und funktionellen Eisenmangel-Erscheinungsformen sind möglich.
Anämie oder Vorstufe?
Die Eisenmangelanämie ist laut WHO mit Hämoglobinwerten unter 13 g/dl (bei Männern) bzw. unter 12 g/dl (bei Frauen) definiert und wird in unterschiedliche Stadien eingeteilt, wobei erste Symptome bereits bei normalem Blutbefund ohne anämische Anzeichen auftreten können. Bei konkretem Anämie-Verdacht sollten labordiagnostisch vor allem biochemische Marker des Eisenstoffwechsels wie Ferritin, löslicher Transferrin-Rezeptor (sTFR), Zinkprotoporphyrin (ZPP), Transferrin-Sättigung (TfS) sowie hämatologische Untersuchungen des Blutbildes, Erythrozytenindices wie mittleres Zellvolumen (MCV), mittlerer Hämoglobingehalt (MCH) oder mittlere Hämoglobinkonzentration (MCHC) und Entzündungsmarker (CRP) analysiert werden.
Supplemente
Eine Eisensupplementierung sollte immer dann erfolgen, wenn eine manifeste Eisenmangelanämie besteht. Ein Eisenmangel ohne bestehende Anämie erfordert ein individualisiertes Vorgehen, wobei die Entscheidung über den Zeitpunkt und die Art der Therapie von Symptomatik, Ätiologie, Schweregrad, Dynamik des Hämoglobin-Abfalls, Komorbidität sowie den Risiken der Therapie abhängig ist. Neben der Empfehlung einer eisenbewussten, abwechslungsreichen Ernährung stehen zwei Applikationswege zur Substitution zur Verfügung:
• Orale Gabe von Eisen (II)- bzw. Eisen (III)-Verbindungen (v. a. Fumarat, Gluconat, Sulfat)
• Intravenöse Applikation von Eisen (III)-Komplexen
Eine orale Supplementierung von Eisen ist möglich und zu bevorzugen, sofern keine absoluten Indikationen für eine intravenöse Therapie (z. B. Unverträglichkeit der oralen Therapie, rasche Eisenzufuhr notwendig) bestehen. Es wird empfohlen, Präparate 30 bis 60 Minuten vor der Mahlzeit in einer niedrigen Dosierung einzunehmen und den Therapieerfolg nach einem Monat zu überprüfen. Die Resorption über den Gastrointestinaltrakt kann durch Zusatz von Vitamin C und organischen Säuren gesteigert werden. Durch Kaffee, Tee, Milch und Lebensmittel, die Phytinsäure, Polyphenole, Soja-Protein, Ei-Albumin, Casein oder Calcium enthalten, wird die Resorption beeinträchtigt.
Unerwünscht, aber häufig
Zu den Nebenwirkungen einer oralen Eisensubstitution zählen Beschwerden des Gastrointestinaltraktes wie Obstipation, Völlegefühl, Sodbrennen, abdominale Blähungen, kolikartige Magenschmerzen, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall. Eine im Verlauf der Behandlung auftretende dunkle bis schwarze Färbung des Stuhls kann auf den Eisengehalt zurückzuführen sein und gilt als unbedenklich.
Interaktionen beachten
Eisenpräparate zeigen insbesondere in Kombination mit folgenden Substanzen Wechselwirkungen, was die Einhaltung eines zeitlichen Abstands von mindestens zwei Stunden erforderlich macht.
• Antacida, Ca2+- und Mg2+-Ergänzungspräparate, Colestyramin: ↓ Resorption von Eisen
• Bisphosphonate: ↓ Resorption von Bisphosphonaten
• Chinolon-Antibiotika: ↓ Resorption von Chinolon-Antibiotika
• Levodopa, Methyldopa, Carbidopa: ↓ Resorption von Levodopa, Methyldopa und Carbidopa
• NSAR: ↑ Reizwirkung des Eisens auf die Schleimhaut des Magen-Darm-Traktes
• Penicillamin: ↓ Resorption von Penicillamin
• PPI: ↓ Eisenresorption aufgrund verminderter Magensäureproduktion möglich
• Tetrazykline: Wechselseitige Behinderung der Resorption
• Thyroxin: ↓ Resorption von Thyroxin
• Tokopherol: ↓ Wirkung von Tokopherol
• Zink: ↓ Resorption von Zink
Schädliche Überladung
Die unkontrollierte Einnahme von Eisenpräparaten bzw. Erkrankungen wie Sichelzellanämie, Thalassämie, myelodysplastisches Syndrom sowie Hämochromatose können zu einer Überladung des Körpers mit dem essenziellen Mikronährstoff führen. Je nach Krankheitsstadium, Ausmaß der Überladung und Schwere der Organschädigung gelten Müdigkeit, Gelenkschmerzen und Kardiomyopathien bis hin zu Erkrankungen wie Diabetes mellitus oder hepatozellulärem Karzinom als klinische Anzeichen.
Quellen
• S1-Leitlinie: Eisenmangelanämie (2021), AWMF Reg.Nr. 025-021.
• Onkopedia Leitlinie: Eisenmangel und Eisenmangelanämie 2025.
• Austria-Codex Fachinformationen Tardyferon 80 mg Retardtabletten, Ferretab Kapseln.
• DGE, Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (https://www.dge.de/).
• Farrag K, et al.: Neue Optionen der oralen Eisensubstitution. Arzneimitteltherapie 2019; 37: 105-112.
Weitere Literatur auf Anfrage